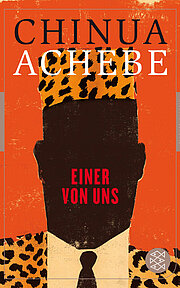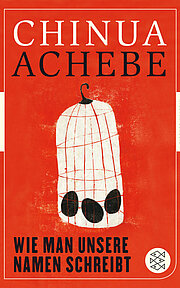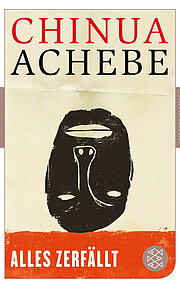Theodor Berchem
Die Geschichte ist unser Begleiter, ohne sie sind wir blind
Laudatio
Ein »Klassiker schon zu Lebzeiten«[1], so urteilte man bereits vor mehr als 20 Jahren über Chinua Achebe. Seine Bücher wurden in mehr als 50 Sprachen übersetzt; nicht nur einer, sondern gleich zwei seiner Romane (»Okonkwo« und »Der Pfeil Gottes«) zählen nach der Wertung einer internationalen Jury vom Februar dieses Jahres zu den 100 besten afrikanischen Büchern des 20. Jahrhunderts.[2] Sein Erstlingswerk »Okonkwo oder Das Alte stürzt« aus 1958 machte den damals 28-jährigen Autor über Nacht international bekannt und ist inzwischen längst in den Kanon der bedeutendsten englisch-sprachigen Romane aufgenommen worden.
»Einigen von uns«, so Achebe in seinem Roman »Termitenhügel in der Savanne« (1987), »hat der Besitzer dieser Welt die Gabe zugeteilt, ihren Mitmenschen zu sagen, dass die Zeit zum Aufstehen endgültig gekommen ist. Anderen schenkt er die Bereitschaft aufzustehen, wenn sie den Ruf hören,... um dem hereinbrechenden Feind mit kühnem Mut im Kampf entgegenzutreten. Und dann gibt es noch jene, deren Aufgabe es ist, zu warten und weiterzumachen, wenn der Kampf vorüber ist, um dann über die Geschichte des Kampfes zu berichten...
Die Geschichte, nicht Kriegstrommel noch Kampf, bewahrt unsere Nachfahren davor, wie blinde Bettler in die Stacheln des Kaktuszauns zu fallen. Die Geschichte ist unser Begleiter, ohne sie sind wir blind.. .«[3]
In diesen Zeilen klingt die besondere historische Situation an, in der Achebes Romane entstanden sind, und darüber hinaus formulieren sie ein zentrales Anliegen des Autors, weil sie deutlich machen, worin unser heutiger Ehrengast seine Aufgabe als Schriftsteller sieht, wie eng seine Literatur mit der Sache des Friedens verknüpft ist und weshalb der Börsenverein dieses Jahr die Entscheidung getroffen hat, ihm den Friedenspreis zu verleihen.
Als Achebe zu schreiben begann, war Afrika im Aufbruch: 1957 war die Goldküste als erster (west-)afrikanischer Staat unter dem Namen Ghana unabhängig geworden, 1958 entschied sich Guinea in einem Referendum gegen den Verbleib in der Union française und für die Unabhängigkeit, es folgten 1960 unter anderen die Unabhängigkeit Nigerias und des Belgischen Kongo, und bis 1966 waren schließlich alle ehemaligen englischen und französischen Kolonien in West- und Äquatorialafrika unabhängig.
»Okonkwo oder das Alte stürzt« schildert die ersten Kontakte der Ibo-Gesellschaft, einer der drei großen Ethnien des Vielvölkerstaates Nigeria, mit dem britischen Kolonialismus Ende des 19. Jahrhunderts.
Die Geschichte des 1964 erschienenen Romans »Der Pfeil Gottes« spielt gut 20 Jahre später und beschreibt die Auseinandersetzungen des Priesters Ezeulu und seines Dorfes Umuaro mit der englischen Kolonialverwaltung, die sich mehr und mehr ausgebreitet hatte.
Die Rückbesinnung auf die eigene Geschichte und die damit verbundene Neubewertung der Vergangenheit, die auch schon in der Namenswahl der ehemaligen Goldküste anklingt - es nannte sich nach dem historischen Reich Ghana, einer der Hochkulturen der vorkolonialen Zeit in Afrika -, war den meisten Autoren und Intellektuellen der Zeit ein zentrales Anliegen. Die beiden Romane Achebes sind beispielhaft für das damalige literarische Schaffen in Westafrika.
Rückbesinnung und Neubewertung des afrikanisch-europäischen Kulturkontaktes sind Leitbegriffe in seinem Werk: »Ich wäre schon zufrieden, wenn meine Romane, besonders jene, die in der Vergangenheit spielen, nichts weiter bewirkten, als meine afrikanischen Leser zu lehren, dass ihre Vergangenheit - mit all ihren Unzulänglichkeiten - nicht eine lange Nacht der Barbarei war, aus der die ersten Europäer sie im Namen Gottes erlöst haben.«[4]
Unser Preisträger wollte und will die Rehabilitierung der vorkolonialen afrikanischen Gesellschaften; wer allerdings erwartet, in seinen Romanen eine reine Apologie dieser Gesellschaften vorzufinden, muss mit einigem Staunen feststellen, dass sich bei der Beschreibung der Dorfgemeinschaften Positives mit Negativem mischt und dass die Romanfiguren nicht idealisiert werden.
In »Okonkwo« und in »Der Pfeil Gottes« wird zum ersten Mal die Geschichte der Ibo aus ihrer eigenen Perspektive erzählt. Dass es Achebe dabei gelingt, ein authentisches Bild der traditionellen Gesellschaft, auf die die Engländer trafen, zu rekonstruieren, ohne einen anthropologischen Traktat zu schreiben, ist eine literarische Meisterleistung und unterscheidet seine von vielen anderen früheren Werken der afrikanischen Literatur. Gleichzeitig bestechen seine Romane durch ihren kunstvollen Umgang mit der englischen Sprache: Um die Erzählkunst seines Volkes in die schriftliche Form (der ursprünglich fremden Gattung Roman) zu gießen, ohne dass ihre Originalität darunter leidet, lässt Achebe in Duktus und Idiomatik weitgehend seine Muttersprache, das Ibo, aufscheinen und flicht eine Fülle von Sprichwörtern seines Volkes ein, mit denen die Protagonisten ihre Erfahrungen einordnen, ihr Vorgehen begründen und ihre Debatten rhetorisch würzen. Vor den Augen des Lesers entsteht so plastisch das Bild einer von tiefer Religiosität und Lebensweisheit durchdrungenen Gesellschaftsordnung mit einem ethisch-moralischen Sittenkanon, nach dem die Menschen leben - oder gegen den sie verstoßen. Wir erhalten damit eine Vorstellung vom täglichen Leben im vorkolonialen Afrika, für das sich die Menschen feste - aber keineswegs zeitlos gültige - Regeln gegeben haben. Achebes Afrika ist keine unschuldige Idylle, aber es hat Kultur, was ihm in der europäischen Literatur bis dahin weitgehend abgesprochen wurde.
Wenn uns diese differenzierte, fein nuancierte Darstellung heute als ein selbstverständliches Qualitätsmerkmal guter Literatur erscheint, dann ist doch daran zu erinnern, dass eine solche Beschreibung in den 50er Jahren ein Novum und ein Wagnis bedeutete. Ein Novum, weil Afrikaner bis dahin in der Literatur vor allem als Barbaren oder als ewige Kinder ohne Verantwortungs-, Scham- und Ehrgefühl gezeichnet wurden: Sie bildeten entweder - unverständliche Laute von sich gebend - die Kulisse für die Taten (oder auch Untaten) der europäischen Helden (wie etwa in Joseph Conrads »Herz der Finsternis«), oder sie blieben als namenlose Lakaien literarische Staffage. Wenn sie - was selten einmal der Fall war - im Zentrum der Romanhandlung standen (wie etwa in Joyce Carys »Mister Johnson«), dann nur, um zu belegen, dass ihr Versuch, Europäer nachzuahmen oder gar in ihre Positionen aufzusteigen, ein klägliches, zum Scheitern verurteiltes Unterfangen war.
Ein nicht geringes Wagnis bedeuteten Achebes Romane deshalb, weil die Gefahr bestand, dass der Leser - durch europäische Literatur und europäische Geschichtsschreibung geprägt - die negativen Aspekte, die er natürlich auch schildert, überbewerten und sich in seinen Vorurteilen bestätigt finden würde. Wie selbstverständlich diese Vorurteile damals noch Allgemeingut waren, daran hat Achebe in seiner Eröffnungsrede zum »Festival der Weltkulturen Horizonte '79« erinnert, wo er einen britischen Kolonialgouverneur in Rhodesien zitiert, der in den 50er Jahren - also zur Entstehungszeit von »Okonkwo« - die »Partnerschaft zwischen Schwarz und Weiß als die Partnerschaft zwischen dem Pferd und dem Reiter formulierte«.[5]
»Okonkwo« und »Der Pfeil Gottes« entziehen sich allzu einfachen und eindeutigen, eindimensionalen Antworten. Bis heute geben sie immer wieder Anlass zu neuen Interpretationen. Vor dem Hintergrund der letzten Jahre kann man in ihnen geradezu prophetische Züge entdecken. Denn was Achebe mit seinen Hauptfiguren beispielhaft demonstriert, sind die Mechanismen zunehmender Verhärtung - einer Fundamentalisierung, wie wir heute sagen würden -, die nicht selten die Reaktion auf einen Kulturkontakt ist, bei dem die machtpolitischen und die ökonomischen Mittel extrem ungleich verteilt sind. Diese fundamentalistische Übersteigerung der eigenen Wertvorstellungen ist es, die in den Romanen den Zerfall der Gesellschaft, die beide Protagonisten eigentlich verteidigen wollen, nur noch beschleunigt und sie selbst schließlich in den Selbstmord oder den Wahnsinn treibt.
Indem die Notwendigkeit eines permanenten Wandels grundsätzlich bejaht wird, nehmen die beiden Romane bereits in den 50er Jahren die Diskussion um den Begriff der kulturellen Identität vorweg, die Jahrzehnte später, gegen Ende des 20. Jahrhunderts, im Gefolge der zunehmenden Globalisierung von zentraler Bedeutung werden sollte und uns inzwischen deutlich gemacht hat, dass das Konzept der statischen, »auf eine einzige Zugehörigkeit reduzierten« Identität persönliche und nationale Konflikte geradezu heraufbeschwört.[6]
Achebe selbst, dessen Vater als einer der ersten seines Dorfes zum Christentum übergetreten war und seine Kinder religiös streng erzog, wuchs in beiden Welten auf, da er von frühester Kindheit immer auch Kontakt mit nicht konvertierten Freunden und Kameraden hatte. Er bedauert zwar, dass er dadurch von bestimmten traditionellen Bräuchen ausgeschlossen blieb. Andererseits sei er aber in gewissem Sinn auch privilegiert gewesen, da er beide Kulturen mit genügender Distanz beurteilen konnte. Ebenso hat er hervorgehoben, dass er damit keineswegs alleine stand, und er belegt die grundsätzlich für das Neue offene Haltung seines Volkes mit einem alten Ibo-Sprichwort: »The world is a dancing masquerade. If you want to understand it, you can't remain Standing in one place.«[7]
Die Welt ist eine Art Maskenball. Wenn man sie verstehen will, kann man nicht an einer Stelle verharren. Da die Welt sich kontinuierlich ändere, seien auch die Menschen immer und überall gezwungen, sich zu verändern und sich anzupassen. Selbst alte und sehr schöne Bräuche sind möglicherweise irgendwann einmal nicht mehr nützlich. Dann müsse man bereit sein, etwas Neues auszuprobieren. Dies gelte auch für den Kontakt zwischen den Kulturen, der gegenseitige Bereicherung und Weiterentwicklung bedeute - sofern er friedlich und unter gleichberechtigten Partnern stattfinde.
Der Roman »Heimkehr in fremdes Land« (englisch »No Longer at Ease« von 1960) zeigt, dass der Versuch, unterschiedliche Sozialisationssysteme und differente kulturelle Welten erfolgreich zu einer neuen Synthese zusammenzuführen, dann zum Scheitern verurteilt ist, wenn nur pragmatisch - ohne festen Wertekodex als Grundlage - jeweils nur das übernommen wird, von dem sich der Einzelne persönliche Vorteile verspricht. Auch dieses Werk - dessen englischer Titel eine Zeile aus T. S. Eliots »Journey of the Magi« (»Die Reise aus dem Morgenland«) ist - wurde sehr bald ins Deutsche übersetzt. Für die jetzige Neuübersetzung hat man zu Recht auch einen neuen Titel gewählt; denn der alte, »Obi, ein afrikanischer Roman« (1963), wäre ein Anachronismus. Zu deutlich drückte er noch die Überraschung darüber aus, dass es so etwas wie afrikanische Literatur überhaupt gab. Die Situation hat sich aber seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts spektakulär geändert. Seitdem sind in Afrika eine Fülle von Romanen, Erzählungen, Gedichten und Dramen entstanden, und nicht wenige dieser Werke zählen inzwischen uneingeschränkt zur Weltliteratur.
Auf die kritische Distanz, mit der Achebe die eigene Gesellschaft schon in »Okonkwo« und »Der Pfeil Gottes« schilderte, folgt in diesem Roman die minutiöse Analyse der Probleme, mit denen die afrikanischen Eliten von heute sich konfrontiert sehen, und er hält ihnen und ihren moralischen Schwächen natürlich rigoros den Spiegel vor. »A Man of the People« (1966) schließlich - das noch nicht auf Deutsch vorliegt - wird zur beißenden Satire auf die politischen Verhältnisse in einem unabhängigen afrikanischen Land, das sich unschwer als das damalige Nigeria erkennen lässt.
Die Geschichte endet damit, dass das Militär die korrupte Zivilregierung stürzt, und nimmt so die nachfolgende Entwicklung Nigerias vorweg. Nur kurze Zeit nach der Veröffentlichung putschte das Militär tatsächlich. Da das als föderativer Staat in die Unabhängigkeit entlassene Nigeria unter der damaligen - vom zahlenmäßig weit überlegenen Norden dominierten - Regierung in Korruption und Bürgerkrieg zu versinken drohte, rissen zu Beginn des Jahres 1966 Ibo-Generäle unter Führung von General Ironsi die Macht an sich. Bereits im Juli allerdings stellte ein Gegenputsch die alten Machtverhältnisse im Staat - unter neuen Militärs - wieder her.
Die Massaker an der Ibo-Bevölkerung, die nun folgten, kosteten Tausende das Leben[8] und führten 1967 zur Sezession der Ibo-dominierten Ostprovinz unter dem Namen Biafra. Achebe, der nach den massiven Übergriffen auf die Ibo-Bevölkerung aus Lagos in seine Heimat nach Ostnigeria zurückgekehrt war, musste um sein Leben fürchten und das Land verlassen; er war nicht zuletzt deshalb zur Zielscheibe der Mächtigen geworden, weil man dem Schluss von »A Man of the People« mehr als eine zufällige Vorausahnung unterstellte. Während des dreijährigen blutigen Bürgerkriegs, der der Sezession folgte, unternahm er zahlreiche Reisen in Europa und Afrika, um für die Unabhängigkeit Biafras zu werben.
Diese war jedoch - aus Gründen, die hier nicht zu erörtern sind - zum Scheitern verurteilt.
Nach der bedingungslosen Kapitulation Biafras im Jahre 1970 kam es nicht zu den befürchteten offenen Rachemaßnahmen an den Ibos,[9] man bemühte sich stattdessen intensiv um ihre schnelle Wiedereingliederung.
Chinua Achebe kehrte nach Nigeria zurück, um seinen Beitrag zum Aufbau des politisch wieder vereinten Landes zu leisten. Literarisch verarbeitete er das traumatische Erlebnis des Bürgerkriegs, in dem mindestens eine Million Menschen - manche Schätzungen gehen sogar von zwei Millionen aus - den Tod fanden, in einer Sammlung von Kurzgeschichten, »Girls at War«, und in dem Gedichtband »Beware, Soul Brother«, beide 1972. Eine wichtige Voraussetzung für dauerhaften Frieden, dies wird dabei deutlich, besteht für ihn darin, die Erinnerung an die dahingemetzelten Opfer wach zu halten.
Gedenktag
»Eure Trauerkundgebungen eure
auf Halbmast geflaggte Fahne
eure feierlichen Gesichter euer
schneidiger Trauermarsch euer
Salut am blumengeschmückten
leeren Grab eure glorreichen
Worte - nichts, gar nichts wird
ihren Geist befrieden...
Drum fürchtet sie! Fürchtet ihren Groll
furch tet eure gefallenen Blutsverwandten
die ums Leben betrogen wurden.. .«[10]
Noch deutlicher warnte er 1975 in dem Essayband »Morning Yet on Creation Day« davor, den Bürgerkrieg voreilig als eine einmalige Entgleisung und ein endgültig abgeschlossenes Kapitel der Geschichte abzutun:
»Ich glaube«, schrieb er, »dass in unserer Situation die größere Gefahr nicht darin liegt, dass wir uns erinnern, sondern darin, dass wir vergessen,... ich glaube, dass Nigeria, das immer zur Selbsttäuschung neigt, einen großen Bedarf an Menschen hat, die die Erinnerung wach halten.«[11]
Achebes Rückkehr nach dem Krieg bedeutete nicht, dass er sich kritiklos mit den in den kommenden Jahren aufeinander folgenden Militärregierungen arrangierte, ganz im Gegenteil. Den Essayband »The Trouble With Nigeria« ('83) beginnt er mit dem Verdikt: »Das nigerianische Problem ist schlicht und einfach das Versagen seiner Führungsschicht.« Die systematische Selbsttäuschung derer, die sich unrealistischen Erwartungen hingeben und vor den wahren Problemen des Landes die Augen verschließen, stellte er ebenso an den Pranger wie die Duldung von Vorurteilen politischer, religiöser oder sexistischer Natur, die die zur Entwicklung eines modernen Staates nötigen Fundamente unterminieren. Die Eliten warnte er, nicht der Gefahr zu erliegen, sich angesichts der schier unüberwindlichen Schwierigkeiten aus ihrer politischen Verantwortung zurückzuziehen.
Es sei stattdessen ihre vordringliche Aufgabe, die Erfahrungen der Geschichte kreativ zum Aufbau einer besseren Zukunft zu nutzen.[12]
Noch deutlicher als in den vorausgehenden Schriften steht in dem bisher letzten Roman »Termitenhügel in der Savanne« die Verantwortung der Afrikaner selbst für ihre gegenwärtige Situation im Vordergrund. Die Frage, weshalb und ab wann die Entwicklung in Nigeria so grundlegend falsch gelaufen ist, und »was ein Volk tun (muss), um seine verbitterte Geschichte zu besänftigen«,[13] zieht sich als Leitfaden durch das Handlungsgeschehen und ist in den Überlegungen, Selbstzweifeln und Selbstvorwürfen der vier Protagonisten stets gegenwärtig.
Als Repräsentanten der »lost generation«, jener Afrikaner also, die den Glauben an die nahezu unbegrenzten Möglichkeiten, die für ihre Väter mit der Unabhängigkeit verbunden waren, verloren haben, befinden sie sich in einer tiefen Sinn- und Identitätskrise. Ihre Überlegungen über die Beziehung zur eigenen Geschichte, über die Ziele und Grenzen des eigenen Handelns beim Aufbau einer besseren Gesellschaft, ihre unterschiedlichen Sichtweisen und Erklärungsversuche werden in den einzelnen Kapiteln ohne übergeordnete Erzählinstanz gegenübergestellt: »Schriftsteller verschreiben keine Rezepte. Sie bereiten ihren Lesern Kopfschmerzen«, so formuliert es Ikem, einer von ihnen.[14]
Bei der Frage, wie die alten Ideale zu neuem Leben erweckt oder durch andere, ebenso wirkungsmächtige ersetzt werden könnten, oder wie die heterogenen Bevölkerungselemente mit 250 Sprachen in ihrem Staat zu einem einheitlichen Ganzen zusammenwachsen könnten, in dem alle gleichermaßen zu ihrem Recht kommen, bleibt die Antwort in der Schwebe. Die Hoffnung aber, dass die Vergangenheit bei der Suche nach einer gemeinsamen Ethik und neuen, gemeinsamen Wertvorstellungen ein verlässlicher, unverzichtbarer Wegweiser sein könnte, scheint nicht unbegründet. Was immer man ist - so Achebes Überzeugung -, es kann nie genügen; man muss Möglichkeiten finden, andere zu akzeptieren und einiges von ihnen zu übernehmen; denn nur das bewahrt uns davor, »der tödlichen Sünde von Selbstgerechtigkeit und Extremismus zu verfallen«.[15]
Über die politische Dimension hinaus zeichnen sich Achebes Romane durch einen von Beginn an vorhandenen, zunehmend deutlicher werdenden metaliterarischen Diskurs aus. Dieser ist schon in den ersten drei Romanen, »Okonkwo«, »Heimkehr in fremdes Land« und »Der Pfeil Gottes«, unterschwellig als Gegendarstellung zur europäischen Literatur über Afrika vorhanden. Im letzten Roman, »Termitenhügel in der Savanne«, steht die Frage nach der Funktion der Literatur im postkolonialen Afrika sichtbar im Vordergrund. Und in den Essays - ab den 70er Jahren - bildet die theoretische Auseinandersetzung mit dem Afrikabild der europäischen Literatur den Schwerpunkt - zusammen mit der Frage, wie sich die Voraussetzungen für einen gleichberechtigten Dialog zwischen Afrika und der westlichen Welt schaffen lassen. Beide Problemfelder sind nicht voneinander zu trennen, was Chinua selbst spätestens bei der Lektüre von Joyce Carys Roman »Mister Johnson« erkannte. Nach Achebe kann »... Fiktion - obwohl sie natürlich fiktiv ist - durchaus wahr oder falsch sein,... nicht in dem Sinne wie Nachrichten wahr und falsch sind, sondern abhängig von der jeweiligen Interessenslage, der Intention und der Integrität des Autors«[16] - und Letztere spricht er Joyce Cary ab, obwohl dessen Roman seinerzeit laut »Time Magazine« als »der beste Roman galt, der je über Afrika geschrieben wurde«.[17]
Die ausführliche Analyse in »Hopes and Impediments« von Joseph Conrads 1899 erschienener Novelle »Heart of Darkness« - in der westlichen Welt uneingeschränkt als Klassiker geltend - nimmt in Achebes theoretischen Äußerungen über Literatur eine zentrale Stellung ein.[18]
Conrads Novelle »Herz der Finsternis« entspreche dem »Verlangen - man könnte sogar sagen, (dem) Bedürfnis -, das es in der westlichen Psychologie gibt, Afrika als Folie für Europa auszugeben, als Ort der Negationen, zugleich entlegen und doch irgendwie vertraut, vor dem Europas eigener Stand spiritueller Gnade sich abhebt.«[19] Sie »entwirft das Bild von Afrika als >der anderen Welt<, der Antithese zu Europa und also zur Zivilisation«:
»Conrad«, so fährt Achebe fort, »wählte sein Thema gut - ein Thema, das ihn garantiert nicht mit den psychologischen Anfälligkeiten seiner Leser in Konflikt bringen oder ihn vor die Notwendigkeit stellen würde, ihren Widerstand zu brechen. Er wählte die Rolle des Lieferanten tröstlicher Mythen.«[20]
Die eingehende Analyse der rassistischen Untertöne in Conrads Novelle löste, wie zu erwarten war, zum Teil sehr polemische Reaktionen unter Rezensenten, Kritikern und Literaturwissenschaftlern aus. Aber, wie immer man zu »Herz der Finsternis« stehen mag, eines hat die Kontroverse ganz gewiss bewirkt: Sie hat den blinden Fleck auf unserem Auge sichtbar gemacht, der es uns ermöglichte, genau die Aspekte, die Achebe in den Vordergrund stellte, aus der Lektüre auszublenden. Und dass dies geschehen konnte, ohne dass es uns bewusst wurde, macht im Nachhinein unsere Betroffenheit nicht erträglicher und unsere Befangenheit kaum verständlicher.
»Herz der Finsternis« erschien vor mehr als 100 Jahren, und natürlich ist es auch im Kontext seiner Zeit zu beurteilen. Wer nun allerdings glaubt, man könne daher Achebes Kritik einen zwar berechtigten, aber inzwischen überholten Platz in der Literaturdebatte zuweisen, der sei gewarnt: Conrads Novelle wurde ganz sicher nicht zu Unrecht im Sinne von Freud gedeutet; das, was der Autor als das »Herz der Finsternis« beschreibt, ist in der Tat unser dunkles Inneres, das verdrängte Bewusstsein unseres Kulturkontaktes mit Afrika.
»Die Geschichte ist unser Begleiter, ohne sie sind wir blind.« Die Revision unserer Vorstellung vom so genannten dunklen Kontinent und der im Gefolge von Sklaverei und Kolonialismus entstandenen Ideologien setzt die Bemühungen und den guten Willen beider Seiten voraus: »Wir hängen alle zusammen. Man kann nicht die Geschichte des einen erzählen, ohne die anderen mit einzubeziehen.«[21]
Mehrere Jahrhunderte rassistischen Denkens haben Spuren im europäischen Bewusstsein und - noch fataler - im Unterbewusstsein hinterlassen, die nicht leicht zu tilgen sein werden.
Wir wissen zu wenig voneinander, und es ist sogar wahrscheinlich, dass man in Europa weit weniger über Afrika weiß als umgekehrt: Zu lange haben wir uns in der Geschichts- und Literaturgeschichtsschreibung darauf beschränkt, die erfolgreiche »Erkundung« des Kontinents nur aus unserer Sicht zu glorifizieren und dabei die andere Seite auszublenden. Die Folgen des zumindest defizitären Afrikabildes, die Probleme, die nicht zuletzt aus der Geschichte des europäisch-afrikanischen Kulturkontaktes entstanden, werden nicht nur die Afrikaner, sondern auch uns noch lange begleiten.
Daher werden auch wir uns - Europäer und Amerikaner - wie Chinua Achebe nicht müde wird, zu betonen - an die Geschichte erinnern müssen. Und wenn es zueinem wirklichen Dialog und zu gedeihlicher Zusammenarbeit für eine bessere Zukunft der ganzen Welt kommen soll, dann werden wir als erstes die Historie an unseren Schulen nicht weiterhin so selektiv vermitteln dürfen wie bisher: Noch immer beginnt die Geschichte Afrikas in unseren Schulbüchern - im Kapitel »Zeitalter des Imperialismus« - mit der Ankunft der Europäer. Wer von uns hat jemals von der Nok-Kultur gehört, benannt nach dem Fundort der ältesten bisher bekannten Plastiken, die man in Schwarzafrika entdeckte, einer Kultur, die nach neueren Erkenntnissen ca. 1000 vor Chr. entstand und wahrscheinlich 2000 Jahre alt wurde?
Das relativ junge Datum dieser Funde mag eine Entschuldigung für unsere Unkenntnis sein. Dies gilt aber kaum für Wissenslücken bei folgenden Beispielen:
Die Hauptstadt des Königreichs Benin im Südwesten Nigerias, ca. 600 n. Chr. gegründet, war den Europäern bereits im 15. Jahrhundert bekannt und konnte - wie die frühen Reisenden berichteten - durchaus dem Vergleich mit zeitgenössischen europäischen Großstädten standhalten.[22] Seine Kunst war berühmt und gefragt, und zu Tausenden gelangten nach der Kolonisierung wertvolle Bronzen und Elfenbeinschnitzereien in europäische Museen und Sammlungen.
Man müsste auch das Königreich Ghana erwähnen, Blütezeit etwa 800 bis 1080, oder das Königreich Mali (ca. 1235 bis 1400) und seine intellektuellen und wirtschaftlichen Zentren, wie Djenne oder Timbuktu, das eine eigene Universität besaß.[23] Als einer der Könige dieses Reiches (Mansa Musa), der zum Islam übergetreten war, in den Jahren 1324-1326 eine Pilgerreise nach Mekka machte, erregte er mit den Reichtümern, die er verteilte, noch im fernen Europa solches Aufsehen, dass er sogar persönlich auf der ersten europäischen Karte von Afrika (1375) eingezeichnet ist.
Ebenso wenig dürfte heute das Königreich Kongo bekannt sein, das Ende des 14. Jahrhunderts entstand. Seine Herrscher pflegten nach der Ankunft der Portugiesen 1483 zunächst durchaus ebenbürtige Beziehungen zu den Europäern und bekehrten sich sogar zum christlichen Glauben. Sie korrespondierten mit dem Heiligen Stuhl, den sie um Unterstützung gegen den zunehmenden portugiesischen Sklavenhandel baten. Doch obwohl sie in Rom durchaus Unterstützung fanden, war ihnen kein Erfolg beschieden. Denn in den Plantagen der inzwischen entdeckten »Neuen Welt« glaubte man den Bedarf an Arbeitskräften nur durch afrikanische Sklaven decken zu können. In den folgenden Jahrhunderten wurden nach vorsichtigen Schätzungen 15-20 Millionen Schwarzafrikaner als Sklaven nach Nord- und Südamerika und in der Karibik verschifft.[24] Und als die Sklaverei schließlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zuletzt in Brasilien, abgeschafft wurde, begann die Aufteilung des afrikanischen Kontinents unter den europäischen Mächten.
Wir sind zu Recht stolz darauf, im Laufe unserer Ideengeschichte zum Beispiel die Prinzipien des Humanismus, der Aufklärung, der Menschenrechte entwickelt zu haben. Aber zu unserer europäischen Geschichte gehört auch die Kehrseite, nämlich dass wir aus unserem humanistischen Menschenbild jahrhundertelang die Bewohner ganzer Erdteile ausgeklammert haben, indem wir den Rassismus mit seiner ausgeklügelten Hierarchisierung erfanden, der den Schwarzen Menschen auf der untersten Stufe der Skala ansiedelte.
»... welche Fehler der Schwarze auch haben mag«, so Chinua Achebe, »und welche Verbrechen auch immer er begangen hat (und es waren und sind jede Menge), er hat den Rassismus nicht in die Welt gebracht. Und egal wie emanzipiert jemand auch erscheinen möchte, oder wie sehr er sich auch bemühen mag, Großherzigkeit zu zeigen, er kann die Geschichte nicht ungeschehen machen.«[25]
Solange es Rassismus gab, gab es auch Afrikaner, die dessen Thesen Lügen straften - auch hier in Europa: Achebe erwähnt mehrfach einen frühen Schriftstellerkollegen aus dem Volk der Ibo, der 1789, im Jahr der französischen Revolution, eine sehr einflussreiche - und ausgesprochen lesenswerte - Autobiografie verfasste: Olaudah Equiano. Dieser wurde in dem Ibo-Dorf Essaka (heute Iseke) geboren und mit elf Jahren an weiße Sklavenhändler verkauft. Als er sich nach langen Jahren unter wechselnden Herren schließlich freigekauft hatte, ließ er sich in London nieder, wo er für die Abschaffung der Sklaverei kämpfte und seine Lebensgeschichte veröffentlichte:[26] »Ich hatte oft gesehen«, so heißt es dort vom zwölfjährigen Equiano, »dass mein Herr und (mein Freund) Dick sich mit Lesen beschäftigten, und ich war äußerst begierig, selbst mit den Büchern zu sprechen, wie sie es meiner Meinung nach taten, um auf diese Weise zu erfahren, woher alles auf der Welt käme.«[27]
Lange sollten die Bücher für ihn nicht verschlossen bleiben, und seine Vita machte ihn schnell berühmt.[28] Equiano gelang es damit als erstem Schwarzen, in die Literaturgeschichte und in den Dialog mit Europas Büchern einzutreten, und inzwischen sind ihm Legionen afrikanischer Schriftsteller und Intellektueller - darunter an herausragender Stelle Chinua Achebe - gefolgt. Wir Europäer, Westler, sollten endlich ernsthaft anfangen, zuzuhören bei dem, was sie uns zu sagen haben.
»Suggerieren zu wollen«, mit diesen Worten schließt Achebe seinen letzten Essay in »Home and Exile« aus dem Jahr 2000, »dass die Weltkultur bereits existiert, hieße absichtlich die Augen vor der Realität zu verschließen und, schlimmer noch, das eigentliche Ziel als belanglos hinzustellen und so zu verhindern, dass eine Weltkultur, die diesen Namen wirklich verdient, in Zukunft entstehen könnte.... Jene, die glauben, dass Europa und Nordamerika schon im Besitz dieser Kultur seien, der der Rest der Welt nur schnell beizutreten habe, werden meinen Vorschlag als unnütz, wenn nicht gar verrückt erklären. Für andere jedoch, die wie ich glauben, dass diese Kultur bis jetzt noch nirgendwo in Sicht ist, besteht die Aufgabe darin, Überlegungen anzustellen, wie wir zunächst einmal die Voraussetzungen für einen echten Dialog schaffen können.«[29]
Der erste Roman von Chinua Achebe, »Things Fall Apart«, macht einen Vers des Gedichtes »The Second Corning« (Wiedergeburt) von W. B. Yeats zum Titel. Ein Second Corning, eine African Renaissance, findet im kulturellen Bereich längst statt - zum Beispiel in der Musik, im Film und in der Literatur, die uns heute hier zusammengeführt hat. Dass sie auch politisch, wirtschaftlich und sozial möglichst schnell Realität werden kann, daran müssen auch wir Europäer mitarbeiten, denn ich meine, wir haben einiges wieder gutzumachen.
Dazu beizutragen, dass seine Gesellschaft »den Glauben an sich selbst wiedergewinnt, die Komplexe überwindet, die durch lange Jahre der Beleidigung und Selbsterniedrigung entstanden sind«, hat Achebe sich zum Ziel gesetzt. Die »Wunde in der Seele eines jeden Afrikaners«,[30] von der er spricht, sollte uns ein Stachel im Fleische sein.
Lieber Chinua Achebe, Ihr Vorname, den Sie mit Rücksicht auf Ihre internationalen Leser etwas verkürzt haben, lautet eigentlich Chinualumogu, und dies fand ich übersetzt mit den Worten: »Möge Gott für mich kämpfen.« Mit Hilfe eines herausragenden Ibo-Sprechers habe ich Ihren Namen für den heutigen Festakt erweitert, um unser aller Wunsch formulieren zu können: »Chinugidelumogu«: »Möge Gott weiterhin für Sie kämpfen!«
[17] Zit. nach Achebe, Chinua
[20] Ebda. S. 13
[23] Vgl. ebda. 95/96
[25] Achebe: »MorningYeton CreationDay«,a.a.O.S. 16
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck und jede andere Art der Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen, die urheberrechtlich nicht gestattet ist, werden verfolgt. Anfragen zur Nutzung der Reden oder von Ausschnitten daraus richten Sie bitte an: m.schult@boev.de