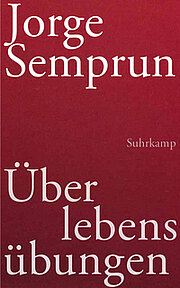Jorge Semprún
Friedenspreisträger 1994
Dankesrede
Es war ein Sonntag, in der Tat, ein schöner Sonntag im März. Graue Wolkenfetzen trieben sanft in einem Himmel, der den Frühling ankündigte. Und der Wind, wie immer, über dem Ettersberg: der Wind der Vergangenheit und der Ewigkeit über Goethes Hügel. Aber es war März 1992, und der Rauch des Krematoriums von Buchenwald stieg nicht mehr in jenen fahlen Himmel, über jene Waldlandschaft mit Buchen und Eichen.
Die Vögel waren zurückgekehrt. Das bemerkte ich als erstes, als ich in den leeren und dramatischen Raum schritt, den Appellplatz. Nachtigallen und Amseln, alle Singvögel waren mit ihrem verworrenen Tirilieren, Trällern und Zwitschern auf die jahrhundertealten Bäume in Goethes Wald zurückgekehrt, aus dem sie Jahrzehnte zuvor von dem ekelerregenden Rauch des Krematoriums vertrieben worden waren.
Eine bunte Vogelschar empfing mich an jenem Sonntag im März 1992, dem Tag meiner ersten Rückkehr nach Buchenwald.
Wenige Wochen zuvor hatte mich Peter Merseburger aus Berlin angerufen. Er bereitete eine Fernsehsendung über Weimar vor, die Kulturstadt und Stadt des Konzentrationslagers, und er schlug mir vor, einer der befragten Zeugen zu sein. Ich lehnte den Vorschlag, fast ohne nachzudenken, sofort ab. Nie hatte ich seit jenem Apriltag 1945, als das Lager von den amerikanischen Soldaten, Pattons dritter Armee, befreit worden war, zurückkehren wollen.
Die Gründe für diese Absage sind kategorisch, sind leicht zu erklären.
Als erstes lagen sie lange Zeit in meinem Entschluß begründet, jene todbringende Erfahrung zu vergessen, um weiterleben zu können. Im Herbst 1945, mit 22 Jahren, fing ich an, jene Lebenserfahrung literarisch zu verarbeiten: jene Erinnerung an den Tod. Aber es war mir unmöglich. Man verstehe mich: Es war nicht unmöglich zu schreiben - es wäre unmöglich gewesen, das Schreiben zu überleben. Das einzige vorhersehbare Ende jenes Abenteuers, Zeugnis ablegen zu wollen, wäre mein eigener Tod gewesen. Das war die Schlußfolgerung, die sich mir sehr schnell aufdrängte.
Natürlich weiß ich, daß dies eine ganz persönliche Erfahrung ist. Andere - Primo Levi zum Beispiel: und er ist ein großartiges Beispiel, sein Werk ist unglaublich reich, reich an Wahrhaftigkeit und luzidem Mitleid - andere also konnten nur mittels des Aufschreibens zum Leben zurückfinden. Mich hingegen stieß jede geschriebene Seite, die ich mir mit Gewalt entreißen mußte, hinein in eine unheilvolle und todbringende Erinnerung, sie raubte mir den Atem mit den Ängsten jener Vergangenheit.
Ich mußte zwischen Schreiben und Leben wählen und entschied mich für das Leben. Aber indem ich mich dafür entschied, mußte ich das Lebensprojekt, Schriftsteller zu werden, aufgeben - ein Vorhaben, das mich sozusagen seit der Kindheit begleitet und mein eigentliches Selbst ausgemacht hatte. Ich mußte mich dafür entscheiden, ein anderer zu sein, nicht ich selbst zu sein, damit ich irgend jemand, irgend etwas sein könne. Denn es war natürlich unvorstellbar, daß ich überhauptetwas schreiben könnte, nachdem ich den Versuch aufgegeben hatte, literarisch über die Erfahrung in Buchenwald Rechenschaft abzulegen.
Das erklärt zum Teil meine Entscheidung für die Politik. Wenn das Schreiben mich in der grauenhaften Erinnerung an die Vergangenheit festhielt, so projizierte mich die politische Tätigkeit in die Zukunft. Das zumindest glaubte ich, bis die Zukunft, die die kommunistische Politik zu gestalten vorgab, ihren unheilvollen Charakter enthüllte: Das war nur eine Illusion der Zukunft.
Der zweite Grund, der es mir unmöglich gemacht hatte, nach Weimar zurückzukehren, war ein ganz anderer. Seitdem ich meine Bücher über die Erfahrung in Buchenwald publiziert hatte - besonders seit »Was für ein schöner Sonntag!« -, bekam ich Nachrichten und Informationen über den Fortbestand des Konzentrationslagers unter dem Regime der sowjetischen Besatzung.
So erhielt ich, zum Beispiel, einen Roman von Peter Pöttgen, »Am Ettersberg«, in dem die doppelte Erinnerung an Buchenwald anhand der Geschichte der Familie Stein erzählt wird: das Konzentrationslager der Nazis und das stalinistische Arbeitslager. In dem Brief, der das Buch begleitete, schrieb mir Pöttgen auf französisch: »Im Winter 1944 lag der Schnee über den Buchen und Baracken, und ich, ein mittelmäßiger vierzehnjähriger Schüler, besuchte ein Gymnasium in Weimar. Ich hörte dem Lehrer kaum zu, der uns einen Goethevers erläuterte...«
Das sind die Gründe, weswegen ich nie den Wunsch verspürte, nach Weimar-Buchenwald zurückzukehren. Deshalb sagte ich Peter Merseburger, daß er für seine Fernsehsendung nicht mit mir rechnen könne: Ich lehnte sofort ab, ohne darüber nachzudenken.
Aber in jener Nacht träumte ich wieder von Buchenwald. Es war nicht der übliche Traum, vielmehr der Alptraum, der mich im Laufe der langen Jahre der Erinnerung so oft hatte hochschrecken lassen. Ich hörte die nächtliche, heisere und gereizte Stimme des SS-Sturmführers, der Wache im Kontrollturm hielt, nicht noch einmal in der Lautsprecheranlage. Diese Stimme, die in den Nächten, wenn die Jagdbomber der Alliierten in das eisige Herz Deutschlands vorstießen, Fliegeralarm gab und den Befehl erteilte, das Krematorium abzustellen, damit die hohen kupferfarbenen Flammen den anglo-amerikanischen Piloten nicht zur Orientierung dienen könnten. Krematorium, ausmachen!
Zitternd, wie immer, voller Angst, wie immer, fiel ich in jener Nacht in den Traum von Buchenwald. Aber es war doch nicht der übliche Traum. Es war kein Angsttraum. Ich hörte nicht die Stimme des wachhabenden SS-Unteroffiziers, der den Befehl erteilte, das Krematorium abzustellen. Ich hörte eine wunderschöne Frauenstimme. Ich erkannte sie sofort: Es war die Stimme von Zarah Leander.
»Schön war die Zeit, da wir uns so geliebt...«
Ein Liebeslied, denn Zarah Leander sang immer Liebeslieder in der Lautsprecheranlage von Buchenwald. Man merkte schon, daß die SS-Unteroffiziere gerne Liebeslieder hörten, gerne diese dunkle, wohlklingende Stimme von Zarah Leander.
Ich wachte aus diesem Traum mit der ruhigen Gewißheit auf, daß ich den Vorschlag von Peter Merseburger doch akzeptieren mußte. Die demokratische Wiedervereinigung Deutschlands hatte die Perspektive zum einen radikal verändert: Meine Vorbehalte von früher waren hinfällig geworden. Zum anderen, das war vielleicht das wichtigste, würde ich das neue Buch, »L'écriture ou la vie« (Schreiben oder leben), an dem ich gerade arbeitete, nicht beenden können, wenn ich die Reise nach Buchenwald nicht noch einmal machen würde.
Ich hatte einige Bücher ausgewählt, die mich auf dieser Reise zurück begleiten sollten. Ich wußte, daß ich nicht die Zeit hatte, sie nochmals zu lesen, aber ich brauchte sie an meiner Seite. Ich mußte sie durchblättern können, sie zur Hand haben können: Sie sollten meine Weggefährten sein. Das erste war eine französische Übersetzung von Thomas Manns »Lotte in Weimar«. Es war nämlich das erste Buch, das ich nach meiner Rückkehr aus dem Lager in Paris gekauft hatte und das damals gerade erschienen war. Seitdem zählt es zu meinen Lieblingsbüchern. Außerdem wußte ich, daß ich im Hotel Elephant wohnen würde, einem historischen Fleck und Schauplatz verschiedener Romane, angefangen mit diesem von Thomas Mann. Und ein Schriftsteller ist immer interessiert an Schauplätzen der Literatur.
Andere Gründe gab es auch, tieferliegende.
Genau an diesem Ort, in diesem nach den Zerstörungen des Krieges 1949 wiedererbauten Rund der Paulskirche, in diesem entscheidenden Jahr der deutschen Geschichte, genau hier hielt Thomas Mann eine denkwürdige Rede. Er sprach im Rahmen der Feierlichkeiten des Goethejahres, genauer zum Gedenken des 200. Geburtstages. Und es war das erste Mal, daß sich Thomas Mann von deutschem Boden aus nach sechzehn Jahren Exil wieder an seine Landsleute wandte.
Von jener Rede aus dem Jahr 1949 möchte ich nur eine Aussage hervorheben, die es mir erlauben wird, mein eigenes Thema fortzuführen.
Hier, auf dieser historischen Tribüne - und ich muß gestehen, welches Risiko es für mich bedeutet und wie wunderbar es ist, nach so vielen hervorragenden Persönlichkeiten heute hier vor Ihnen zu stehen -, hier also behauptete Thomas Mann, damals amerikanischer Staatsbürger, daß das eigentliche, unveräußerliche Vaterland für ihn die deutsche Sprache sei. Niemals wäre ihm der Gedanke gekommen, sagte er, sich auch als Schriftsteller ins Exil zu begeben, in eine andere Sprache auszuwandern, sich womöglich die englische als Literatursprache anzueignen. Mit dem Erbe der deutschen Sprache, sagte er, sei er ins Exil gegangen, in ihr gründe seine wahre Identität, niemals wolle er von ihr lassen, diese Tradition verraten, dieses Vaterland vergessen. Vaterland! Ein schweres Wort, zweifelsohne, und wir wissen, welch schlechten Gebrauch man davon gemacht hat, welche Schlechtigkeiten in seinem Namen geschehen sind. Ich benutze es also mit Vorsicht, wohl wissend, daß Vaterländer nur dann Wege zum Universalismus der demokratischen Vernunft sind - was ihre Aufgabe wäre -, wenn sie weder Vaterlandstümelei noch arrogantes, exklusives Verhalten erlauben. Ich werde es also benutzen und nochmals betonen, daß »Vaterland« niemals »über allem« stehen kann noch darf.
Nachdem dieser Punkt geklärt ist: Ist die Sprache also das Vaterland eines Schriftstellers, wie Thomas Mann behauptet hat? Ich kann das nicht behaupten. In meinem Fall war die spanische Sprache nicht mein Vaterland im Exil, und dies sicher aufgrund meiner Biographie, meines Alters und der besonderen Umstände halber. Sie war in jedem Fall nicht das einzige.
Im Gegensatz zu Thomas Mann habe ich mich nie aus meiner spanischen Staatsbürgerschaft exiliert, wohl aber aus meiner Muttersprache. Eine Zeitlang dachte ich, daß ich ein neues Vaterland gefunden hätte, nachdem ich mir die französische Sprache zu eigen gemacht hatte, in der ich den Großteil meiner Bücher geschrieben habe. Vom Standpunkt der Literatursprache aus gesehen, bin ich also entweder vaterlandslos - da ich ein leidenschaftlicher Zweisprachler bin oder weil ich an unheilbarer linguistischer Schizophrenie leide - wie man will -, oder aber ich habe zwei Vaterländer. Etwas, was in jeder Hinsicht unmöglich ist, wenn man den Gedanken des Vaterlands ernst nimmt: das heißt für etwas nimmt, für das es die Mühe lohnen würde zu sterben. Man kann nicht für zwei verschiedene Vaterländer sterben, das wäre absurd.
Es stimmt auch, daß mir bei den verschiedenen Gelegenheiten, die ich hatte, das Leben zu riskieren, niemals der Gedanke an das Vaterland gekommen ist. Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität mit den Armen und Unterdrückten: Gedanken dieser Art habe ich wohl im Kopf gehabt, wenn die Stunde kam, das Leben zu riskieren, niemals aber den des Vaterlands, das gebe ich zu.
Letztendlich ist mein Vaterland nicht die Sprache, weder die spanische noch die französische: Mein Vaterland ist das Sprachvermögen. Das heißt, ein Raum sozialer Kommunikation und linguistischer Möglichkeiten; es gibt die Chance, das Universum darzustellen, es auch zu ändern, wenngleich dies nur ganz wenig oder am Rande geschehen kann, eben durch dieses Sprachvermögen.
Nun gibt es also in diesem meinem Vaterland, dem Sprachvermögen, Ideen, emblematische Bilder, emotionale Augenblicke, intellektuelle Anklänge, deren Ursprünge spezifisch deutsch sind. Ich wage zu behaupten, daß das Deutsche - in der Dichtung, im Roman, in der philosophischen Reflexion - ein wesentlicher Bestandteil meines geistigen Vaterlands ist. Das liegt sicher daran, daß ich immer ein unersättlicher und begeisterter Leser in Deutsch gewesen bin und bleiben werde. Sogar den »Quijote« habe ich zum erstenmal auf Deutsch gelesen! Ich werde Ihnen jetzt nicht sagen, um nicht von unserem Thema abzukommen, wie das vor sich gegangen ist, noch wie ich versuchte - ein Nacheiferer von Borges' Pierre Menard, ohne daß ich es damals gewußt hätte -, den »Quijote« neu zu schreiben und ihn mit der Arroganz der Jugend aus der germanischen Fassung ins Spanische zu übersetzen...
Eine starke, leidenschaftliche Beziehung verbindet mich also mit der deutschen Kultur, ich hatte und habe sie, sie hat meinen intellektuellen Charakter geprägt. In ihr habe ich die entscheidenden Argumente des Kampfes gegen den Nazismus gefunden. Bei der Lektüre der deutschen Autoren habe ich - wie einer von ihnen, den ich in meiner Jugend gelesen habe, Karl Marx, sagen würde - hier habe ich die Waffen der Kritik gefunden, die es mir dann ermöglichten, den Nazismus mittels der Kritik der Waffen zu bekämpfen.
1949 fuhr Thomas Mann, einige Tage, nachdem er hier, in der Paulskirche, seine Rede über Goethe gehalten hatte, nachWeimar weiter, um sie dort im Nationaltheater zu wiederholen.
Damals, nachdem die Blockade Berlins durch die Sowjetunion zu Ende gegangen war, erinnern wir uns, damals nahm die Teilung Deutschlands in zwei verschiedene Staaten Gestalt an. Der Kalte Krieg legte seine Hauptgrenze ganz sachlich - tragisch - in das Herz Europas, in dieses geteilte und einander feindlich gegenübergestellte Deutschland.
In diesem Zusammenhang stieß die Entscheidung von Mann, die Einladung der Autoritäten der sowjetischen Besatzung und der kommunistischen Instanzen in Ostdeutschland zu akzeptieren, auf breite Kritik. Die Frankfurter Presse erinnerte Thomas Mann daran, daß sich in der Nähe von Weimar das Konzentrationslager Buchenwald befinde und weiterhin benutzt werde. Warum er es nicht nach der Goethe-Rede im Weimarer Theater besuchen wolle, wurde ihm vorgeschlagen.
Thomas Mann scheute vor diesem Problem nicht zurück und verheimlichte es auch nicht. In seiner Rede in der Paulskirche, am 25. Juli 1949, hatte er bereits gesagt, daß sein Besuch Deutschland selbst gelte, dem ganzen Land und nicht dieser oder jener Besatzungszone. Wer könnte die Einheit Deutschlands besser garantieren und repräsentieren, fragte er laut, als ein unabhängiger Schriftsteller, dessen Vaterland die deutsche Sprache sei, die auch von den Besatzungstruppen nicht verletzt werden könne.
Er verweigerte auch nicht eine Aussage zu Buchenwald. In dem »Reisebericht«, den er über seinen Aufenthalt in Deutschland schrieb (und der erstmals in Englisch im »New York Times Magazine« gedruckt wurde und später in Deutsch in der »Neuen Schweizer Rundschau« erschien), versucht Mann, jenen zu antworten, die seinen Entschluß kritisiert hatten. Er sagt, daß er nicht eigens darum gebeten hatte, das Konzentrationslager zu besuchen, daß er aber extraoffiziell versucht hatte, sich über die Lebensbedingungen in Buchenwald zu informieren. Das Ergebnis seiner Nachforschungen ist, so wie er sie referiert, überraschend, hinterläßt in unserer Erinnerung einen bitteren Nachgeschmack. Thomas Mann sagt tatsächlich, daß die Häftlinge, seinen glaubwürdigen Auskünften zufolge, zu einem Drittel aus asozialen Elementen und degenerierten Vagabunden bestehe, ein zweites Drittel aus Verbrechern der Nazizeit und das letzte nur Personen umfasse, die des erwiesenen Widerstands gegenüber dem neuen Staat für schuldig befunden seien und die daher notwendigerweise isoliert werden müßten.
Wenn die Muttersprache wirklich das Vaterland eines Schriftstellers ist, würde eine linguistische, semantische Analyse der Sätze von Thomas Mann genügen, um ihre schreckliche und gefährliche Ambiguität zu beweisen. Denn alle Diktaturen, alle totalitären Systeme erklären die Nonkonformisten stets zu »asozialen Elementen«, zu »degenerierten Vagabunden« (vielleicht Zigeunern?); alle halten es für notwendig, die Gegner und Dissidenten zu »isolieren«, damit deren Ideen und deren Verhalten den gesellschaftlichen Organismus nicht anstecke. Dieser ist angeblich so lange gesund, solange er sich nur von den Informationsquellen des offiziellen Denkens nährt... natürlich des politisch korrekten Denkens.
Die Gründe, die Thomas Mann 1949 bewegten, sind verständlich. Und ehrenwert. Er legte sie nochmals in seinem »Brief« vom Oktober 1954 dar, als er sich der Expansion des Militarismus entgegenstellte, der Wiederbewaffnung, der Militärpakte und sich für die Entmilitarisierung beider deutscher Staaten mit Blick auf ihre Wiedervereinigung aussprach. Alle diese Argumente standen im Zentrum einer weitgespannten Diskussion zwischen den Deutschen. Auch zwischen Europäern, denn das Schicksal Europas war von der Entwicklung der deutschen Politik bestimmt und ist es in gewissem Maße immer noch. Je nach Ausbau der Demokratie in Deutschland, je nachdem wie stark oder schwach seine europäische Verankerung ist, seine Teilnahme an der Festigung und Ausweitung der europäischen Gemeinschaft, natürlich unter gleichen Bedingungen für alle Länder, aus der sie besteht oder bestehen wird; je nachdem wie Deutschland sein Gewicht also in die eine oder andere Richtung bewegt, so wird sich das Schicksal Europas zum Guten oder Schlechten wenden.
Wenn also die Prinzipien des »Briefes« von Thomas Mann ehrenwert waren, waren sie auch historisch gerecht, zeigten sie Wirkung, vergleichbar anderen Botschaften jener letzten Jahrzehnte? War es denkbar, den Frieden in Europa zu erreichen, die deutsche Wiedervereinigung, und zwar mittels einer Versöhnungsstrategie, mittels humanistischer Rhetorik und politischer Toleranz? Damit das kein bloßer ideologischer Schleier sei, mußte man die Existenz von Rechtsstaaten fordern, von stark autonomen und klar gegliederten Zivilgesellschaften mit wirklich demokratischen Repräsentations- und Meinungssystemen, mußte also all das verlangen, was in den Ländern des Sowjetblocks Europas nicht vorhanden war.
Über diesen Punkt habe ich mich schon vor Jahren geäußert. Und ich habe das in dieser Stadt Frankfurt während der Römerberggespräche von 1986 getan, drei Jahre vor dem Fall der Berliner Mauer.
Ich möchte Sie bitten, mir zu erlauben, daß ich hier einen kurzen Auszug aus meiner damaligen Rede zitiere: »Ich möchte nur wenige Worte über das Problem der Teilung Deutschlands sagen - wenn es einem Ausländer überhaupt gestattet ist, sich darüber zu äußern. Aber Sie müssen es erlauben, auch wenn es Sie verärgern oder überraschen mag, denn es handelt sich hier um kein internes Anliegen: Dieses steht im Zentrum der Frage Europas, seiner demokratischen Zukunft. Die Wiedervereinigung Deutschlands ist in jeder Hinsicht notwendig und gleichzeitig undenkbar, wenn sich die historische Perspektive nicht radikal ändert, das Verhältnis der Kräfte zwischen der Demokratie und dem Totalitarismus.
Die Wiedervereinigung Deutschlands muß Ergebnis eines deutlichen Fortschritts der Demokratie in Europa sein, in allen Europas, dem westlichen, dem südlichen, dem östlichen. Aber vor allem in Mitteleuropa, dem ausschlaggebenden Glied, diesem Gebiet, wo jahrhundertelang das kulturelle - um nicht zu sagen das politische - Schicksal der Welt geprägt worden ist.
Sicher wird jemand unter Ihnen sein, der sehr erstaunt ist« (das sagte ich 1986, vergessen Sie es nicht), »daß ich hier über die deutsche Wiedervereinigung spreche als Ergebnis der Demokratisierung Europas - die einzige Revolution, für die es sich zu kämpfen lohnt - und nicht als Ergebnis der Fortschritte von Friedensbemühungen, im Sinne von Entspannung und Abrüstung. Denn die Demokratisierung ist die Wurzel des Friedens, und nicht umgekehrt. Der Frieden, jedenfalls in seiner perversen Form von Beschwichtigung, kann sogar die Wurzel des Krieges sein.«
Ich wiederhole diese Überlegungen von vor acht Jahren nicht als Egoist, aus bloßem Vergnügen, recht gehabt zu haben, denn es war leicht, recht zu haben, man brauchte dafür nur der antifaschistischen Tradition treu zu bleiben. Thomas Mann, der in den 50er Jahren so unfähig war, eine kohärente und wirksame intellektuelle Strategie gegenüber den Problemen von Frieden und Krieg zu entwickeln, hatte doch in den 30er Jahren angesichts des Expansionsdrangs von Hitler seine Weitsicht bewiesen. Er hatte erklärt, daß der Frieden nicht Ergebnis einer Politik sein könne, die auf Aussöhnung und Nachgiebigkeit beruhe. Man kann seine Artikel und Aufsätze jener Jahre noch heute mit Gewinn lesen, zum Beispiel »Leiden an Deutschland« und »Achtung Europa«, vor allem aber den Essay »Dieser Friede«, eine brillante und fürchterliche Schmähschrift gegen die Politik der Kapitulation, wie sie die Demokratien praktizierten. Er veröffentlichte sie in »Die Zukunft«, der Pariser Zeitung der deutschen Emigranten, und zwar nach dem unheilvollen Münchner Abkommen, das Hitler das Herzstück des alten Europas auslieferte.
Der europäische Antifaschismus - insbesondere der deutsche in seiner liebenswert pazifistischen, antinuklearen, ökologischen Version, der in gewisser Weise - und das ist sein positiver Aspekt - die Ungeheuerlichkeiten und den Wahn der nationalen Vergangenheit widerlegt - besagter Antifaschismus ist nämlich seit den 50er Jahren wie einseitig gelähmt. Trotz der Lehren des Spanischen Bürgerkriegs, des deutschsowjetischen Beistandspakts von 1939, trotz der zynischen Machtpolitik der Sowjetunion im Nachkriegseuropa war das westliche antifaschistische Denken mehrheitlich, um nicht zu sagen ganzheitlich, wie gelähmt. Es konnte nur einen Aspekt der Wirklichkeit berücksichtigen -jenen, der sich auf die evidenten Übel und Ungerechtigkeiten unserer Massen- und Marktdemokratien bezieht. Hier hat es eine kritische und überaus notwendige Rolle gespielt. Aber besagtes Denken war nicht imstande, eine globale Theorie und folglich eine Praxis gegenüber dem Totalitarismus zu entwickeln, gegenüber seinen beiden spezifischen historischen Erscheinungsformen: dem Nazismus und dem Stalinismus. Es war nicht imstande, sich dem Problem des Fortbestands des sowjetischen Systems bis in die letzten Konsequenzen zu stellen. In diesem Zusammenhang erlauben Sie mir, daß ich nochmals ein wenig die privilegierte Position mißbrauche, die ich dieser Tribüne verdanke, auf der zu stehen ich heute die Ehre habe, und an einen anderen Abschnitt meiner Rede während der Römerberggespräche erinnere. Er lautete: »Wenn wir die Probleme der Kulturpolitik in diesem historischen Augenblick des Schiffbruchs des Marxismus - als historische Praxis und als Anspruch wissenschaftlicher Wahrheiten - überprüfen; wenn wir versuchen, daß bei diesem Schiffbruch der absoluten Wahrheit weder die Werte noch die Wahrheiten verlorengehen; wenn wir den Blick zurückwerfen auf die so reichhaltigen und tragischen Erfahrungen der 30er Jahre, um etwas zu lernen, dann, ja dann scheint mir, daß wir den bekannten Satz von Max Horkheimer abwandeln müssen, und zwar wie folgt: >Wer vom Stalinismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen.<«
Natürlich gibt es Ausnahmen von dieser Alterskrankheit im Denken der europäischen Linken. Sie sind wichtig, wir haben sie alle im Gedächtnis. Für mich bilden Leben und Werk von Karl Jaspers eine dieser Ausnahmen. Was auch immer die Kritiken und Vorbehalte sein mögen, die wir angesichts gewisser Aspekte seiner existentiellen Metaphysik haben, so war doch die sozio-politische Projektion seines Denkens seit den 30er Jahren immer lehrreich, anregend, wenn nicht beispielhaft.
Deshalb begleiteten mich auch zwei kleine Bände von Karl Jaspers auf meiner Reise zurück nach Weimar-Buchenwald, zurück in die Erinnerung meiner Jugend, in das tragische, universale Vaterland des Sprachvermögens und des Kampfes, der für mich auf dem Goethe-Hügel, auf dem Ettersberg liegt. Deshalb begleiteten mich auf dieser Reise »Die Schuldfrage« und »Freiheit und Wiedervereinigung«, die ich in jenen Nächten im Hotel Elephant durchblätterte, mit der gleichen intellektuellen Erregung wie früher, mit dem Gefühl, daß ihre Aktualität auch in neuen historischen Situationen weiterwirkt.
Es war ein Sonntag, in der Tat, lieber Wolf Lepenies, ein schöner Sonntag im März. Ein Leben später, viele Leben und viele Tode später, stand ich wieder in dem dramatischen leeren Raum des Appellplatzes von Buchenwald. Die Vögel waren zurückgekehrt, der gleiche Wind wehte wieder über dem Ettersberg.
Als ich diese Landschaft betrachtete, hatte ich das Gefühl, daß sich mein ganzes Leben vor mir in der Erinnerung ausbreitete, daß es transparent wurde mit seinen Gefahren und seinen Irrtümern, seinen Verblendungen ideologischer Illusion und seinem hartnäckigen Streben nach Erkenntnis und Klarheit.
Als ich also weiter über den Appellplatz schritt, gegenüber dem massiven Schornstein des Krematoriums stand, erinnerte ich mich an ein Gedicht von Paul Celan. Ein Gedichtband von Celan hatte mich auch auf dieser Reise begleitet:
»... dann steigt ihr als Rauch in
die Luft
dann habt ihr ein Grab in den
Wolken da liegt man nicht eng ...«
In diesem Gedicht, der »Todesfuge«, wir alle erinnern uns, gibt es einen schrecklichen Vers, der leitmotivisch wiederkehrt: »Der Tod ist ein Meister aus Deutschland...«
Dort, in Buchenwald, gegenüber dem Schornstein des Krematoriums, erinnerte ich mich an jenem schönen Sonntag im März 1992 an die heisere, gereizte Stimme des SS-Sturmführers, der in den Nächten mit Fliegeralarm verlangte, den Ofen abzustellen: Krematorium, ausmachen! Hier fragte ich mich, ob dieser schreckliche Vers zutraf: das heißt, ob er wirklich eine absolute Wahrheit beinhaltet, die über allen historischen Bedingtheiten existiert. Ganz offensichtlich nicht. Jener Tod, ja, jener Tod, der Europa verwüstete und die Folge von Hitlers Siegeszug war, ja, er war ein Meister aus Deutschland. Aber alle haben wir den Tod kennengelernt, der im Innern der totalitären Bestie mit anderen Verkleidungen schlummert, im dekorativen Flitterkram anderer nationaler Ursprünge. Ich selbst habe den Tod als Meister aus Spanien gekannt und manchmal gestreift. Und die verfolgten und deportierten französischen Juden der zutiefst französischen Vichy-Regierung haben den Tod als Meister aus Frankreich kennengelernt. Und Warlam Schalamow hat uns in seinen ungeheuerlichen »Erzählungen aus Kolyma« vom Tod als Meister aus Sowjetrußland berichtet.
Die Wahrheit des Verses von Paul Celan ist also eine notwendige, unvergeßliche Wahrheit, aber sie ist relativ, historisch bedingt. Der Tod ist ein Meister aus Menschheit: Das wäre die passende philosophische Formulierung, denn sie würde die permanent vorhandene Fähigkeit des menschlichen Wesens betonen, die ihm von Anbeginn an innewohnende Freiheit, sich für den Tod der Unterdrückung und der Knechtschaft zu entscheiden - gegen das Leben der Freiheit: die Freiheit des Lebens.
Der entscheidende Punkt gründet darin, daß Paul Celan seine »Todesfuge« auf deutsch geschrieben hat. Celan, ein rumänischer Dichter, hat das Vaterland der deutschen Sprache gewählt, und in ihr hat er die Universalität seines Sprachvermögens, seiner Poesie gegründet. Denken wir über die tiefe Bedeutung dieses Zeugnisses nach.
»...wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt
man nicht eng...«
Ich erinnerte mich an jenem schönen Sonntag im März auf dem Appellplatz von Buchenwald an das Gedicht von Celan. Ich dachte, daß der Standort des alten Konzentrationslagers, genau so, wie er heute daliegt, ein privilegierter Platz der europäischen Geschichte ist. Ein tragischer Raum, ohne Zweifel, aber er gibt Auskunft: nicht nur als archäologische Spur einer Vergangenheit, deren Wirkungen noch fortdauern, zumindest teilweise, sondern auch als intellektuelles Laboratorium unserer gemeinsamen Zukunft.
Ich werde das in meiner Schlußbemerkung erklären.
Auf der Seite des Ettersbergs, die nach Weimar blickt, errichtete man, als das Konzentrationslager, das Thomas Mann nicht besuchen konnte oder wollte, von den Regierenden der soeben gegründeten DDR geschlossen wurde, ein gigantisches Mahnmal, Produkt eines monumentalen Architekturverständnisses, das mir größenwahnsinnig und wenig ehrfurchtsvoll scheint, denkt man an die bescheidenen und komplexen Wahrheiten der Vergangenheit. So, als hätten die kommunistischen Autoritäten hier die antifaschistischen Ursprünge ihrer historischen Legitimität bekräftigen wollen, und so verschwendeten sie Unmengen edler Materialien, um ein Mahnmal zu errichten, das allein wegen seines schlechten Geschmacks abscheulich ist: eine Mischung der Bildhauerkunst von Arno Breker und dem sozialistischen Realismus unter Stalin.
Auf der anderen Seite, die den Blick in der Ferne auf die Berge Thüringens freigibt, am Fuß des Ettersbergs, ist der junge Hain eines neuen Waldes gewachsen. Er bedeckt die Teile, wo früher die Baracken des Reviers standen, das kleine Quarantänelager. Er bedeckt auch Tausende von anonymen und nicht identifizierten Toten, die in der kalten Unwirtlichkeit der Massengräber aus der stalinistischen Epoche Buchenwalds ein Grab fanden. Hier liegen, im mächtigen Schweigen des Todes, die »asozialen Elemente«, die »degenerierten Vagabunden«, die »des erwiesenen Widerstands gegenüber dem neuen Staat für schuldig Befundenen«, von denen Thomas Mann glaubte oder glauben wollte, daß sie zwei Drittel der Häftlinge Buchenwalds ausmachten, als er 1949, zunächst in der Paulskirche und dann im Nationaltheater von Weimar, vor seinen Landsleuten eine schöne Rede über Goethe und die Tugenden des Humanismus hielt.
Von den Toten des Nazilagers Buchenwald bleibt uns nur die Erinnerung: Als Rauch in die Luft sind sie gestiegen, ihr Grab ist in den Wolken. Da liegt man nicht eng, wirklich nicht: in der unermeßlichen Weite der historischen Erinnerung, die ständig in Gefahr schwebt, in ein inakzeptables Vergessen zu versinken und die dennoch für Verzeihen und Aussöhnung, sobald es notwendig ist, zur Verfügung steht. Von den Toten des stalinistischen Lagers bleiben uns die Massengräber, die der Hain eines neuen Waldes zudeckt, durch den weder Goethe noch Eckermann spazieren gegangen sind, durch den die jungen Deutschen von heute und morgen aber spazieren gehen sollten.
Deutschland ist nicht das einzige europäische Land, das ein nicht gelöstes Problem mit seinem kollektiven Gedächtnis, mit seinem historischen Gedächtnis hat. Frankreich hat es, wie in diesen Tagen von neuem deutlich wird, da es seinen Politikern, seinen Intellektuellen, generell seinem ganzen Volk bislang nicht gelungen ist, sich ein kritisches, von den Passionen der einen oder anderen Seite gleichweit entferntes und in die Tiefe reichendes Urteil über die Vichy-Zeit und die Resistance zu bilden. Auch Spanien hat es, das sich mit erdrückender Mehrheit und zu Recht für eine kollektive und gewollte Amnesie entschied, um das Wunder eines friedlichen Übergangs zur Demokratie zu schaffen. Aber eines Tages wird es auch den Preis für diesen Prozeß zu zahlen haben.
Das Problem des deutschen Volkes mit seinem historischen Gedächtnis hingegen betrifft uns Europäer alle ganz direkt. Das deutsche Volk ist nämlich seit seiner Wiedervereinigung - als Teil des sozialen und politischen, komplexen und schmerzhaften Prozesses, der aber voller Chancen für die demokratische Vernunft steckt, die besagte Wiedervereinigung impliziert -, Deutschland ist seitdem das einzige Volk Europas, das sich mit den beiden totalitären Erfahrungen des 20. Jahrhunderts auseinandersetzen kann und muß: dem Nazismus und dem Stalinismus. In seinem Kopf und Körper hat es diese Erfahrungen erlebt und kann sie nur überwinden - und ohne daß daraus ein Präzedenzfall wird, könnte man in diesem Zusammenhang einmal den Hegelschen Begriff der Aufhebung verwenden -, kann sie also nur überwinden, indem es beide Erfahrungen kritisch übernimmt und aufhebt, um so die demokratische Zukunft Deutschlands zu bereichern. Von dieser hängt ja, wie ich schon gesagt habe - aber man soll es ruhig wiederholen -, die Zukunft eines demokratisch wachsenden Europas zu einem großen Teil ab.
Buchenwald, besser gesagt, das Binom Weimar-Buchenwald, ist der historische Platz, der diese doppelte Aufgabe am besten symbolisiert: die der Trauerarbeit, um der Vergangenheit kritisch Herr zu werden; die der Ausarbeitung von Grundsätzen für eine europäische Zukunft, damit die Irrtümer der Vergangenheit vermieden werden können.
Ich weiß nicht, welche Pläne die politische und intellektuelle Gemeinschaft Deutschlands hat, was den historischen Raum von Buchenwald betrifft. Es wäre schön, dachte ich an diesem schönen Sonntag im März 1992, wenn der Hügel des Ettersbergs Sitz einer europäischen Institution wäre, die sich dieser Gedächtnisarbeit und dieser demokratischen Weiterentwicklung verpflichten würde.
Meine lieben Freunde, vielen Dank für die verliehene Ehre, für die geteilte Erinnerung, für die Zukunft, die wir gemeinsam bauen müssen.
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck und jede andere Art der Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen, die urheberrechtlich nicht gestattet ist, werden verfolgt. Anfragen zur Nutzung der Reden oder von Ausschnitten daraus richten Sie bitte an: m.schult@boev.de