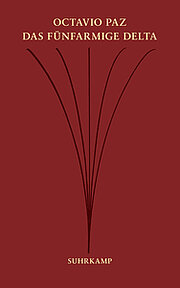Der Stiftungsrat hat den mexikanischen Schriftsteller und Diplomaten Octavio Paz zum Träger des Friedenspreises 1984 gewählt. Die Verleihung fand während der Frankfurter Buchmesse am Sonntag, 7. Oktober 1984, in der Paulskirche zu Frankfurt am Main statt. Die Laudatio hielt Bundespräsident Richard von Weizsäcker.
Begründung der Jury
Den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verleiht der Börsenverein im Jahre 1984Octavio Paz, dem mexikanischen Lyriker, Essayisten, Kritiker und Diplomaten, für den poetische und politische Moral untrennbar sind.
Die Freiheit ist für ihn Grundvoraussetzung für das Miteinander der Menschen. Er beschwört sie in seinen Gedichten, verteidigt sie in seinen Essays und lebt für sie als Bürger und Mensch.
Reden
Günther Christiansen
Grußwort des Vorstehers
Er spricht für Lateinamerika. Dabei stößt er zum Kern des Lebens vor. Indem er es tut, verleugnet er nicht Zeit, Geschichte, Tradition, Geographie, Hautfarbe, soziale Befindlichkeit. Und doch überschreitet er sie zugleich. Er denkt und fühlt, er spricht und dichtet auch für uns. Wie er begabt ist zum Leben und Zusammenleben, so dient er dem Frieden des Menschen mit dem Leben.
Richard von Weizsäcker - Laudatio auf Octavio Paz
Richard von Weizsäcker
Auf den Friedenspreisträger 1984
Laudatio auf Octavio Paz
Mit unseren Kenntnissen von Lateinamerika zählen wir zu den Unterentwickelten dieser Erde, sehr zu unserem eigenen Nachteil. Wir Europäer denken an dortige soziale Ungerechtigkeit und Armut, an fehlende Freiheiten und Menschenrechte. Wir sehen ein Feld der Konfrontation von Großmächten.
Unsere eigenen ideologischen Kämpfe verstärken wir mit halb verstandenen lateinamerikanischen Parolen. Zugleich suchen wir Wirtschaftsbeziehungen, Rohstoffe und Absatzmärkte. Nicht zuletzt deshalb sorgen wir uns um Zinsen und Tilgungen gigantischer lateinamerikanischer Schulden, als deren Gefangene wir uns empfinden.
Das Gefühl politischer und geistiger Überlegenheit der alten Welt hat sich in den Glauben an einen Entwicklungsvorsprung verwandelt, den wir uns in der modernen Welt der Technik und Wirtschaft gegenüber Lateinamerika zuerkennen. So prägen noch immer eine Mischung von Interessen und Unkenntnis, von Gleichgültigkeit und Zukunftssorge unseren lateinamerikanischen Horizont.
Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels setzt mit dem Friedenspreis für Octavio Paz an der entscheidenden Stelle zur Korrektur an: bei der Kultur. Paz bringt uns Lateinamerika mit seinen eigenen Worten ganz nahe: »Imagination, Sensibilität, Liebenswürdigkeit, Sinnlichkeit, Melancholie, eine gewisse Religiosität und ein gewisser Stoizismus gegenüber dem Leben und dem Tode, ein tiefes Gefühl für das Jenseitige und ein nicht weniger ausgeprägter Sinn für das Hier und Jetzt. ... Lateinamerika ist eine Kultur.«
Die Kritik des Mexikaners Octavio Paz am Begriff der Unterentwicklung ist notwendig und heilsam.
Er enthüllt ihn als ein technokratisches Vorurteil, das »die wahren Werte einer Zivilisation, die Physionomie und die Seele einer jeden Gesellschaft geringschätzt«. Ein jedes Volk, auch das mexikanische, ist unterwegs, um seinen Weg in der modernen technischen Welt zu finden. Soll dies gelingen, so muß es ein Weg sein, der auf dem überlieferten und lebendigen Wesen des eigenen Volkes beruht, auf seiner eigenen Kultur. Niemand hat die sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Probleme Lateinamerikas tiefer durchdacht als Octavio Paz. Ihnen gilt sein großes kritisches Werk, seine gewaltige geistige Produktivität.
Was kann im Angesicht der immensen Belastungen und Herausforderungen geschehen? Seine Antwort: Als erstes, klar und unabhängig denken; sodann, vor allem, sich nicht der Passivität ergeben.
Danach hat er sich selbst stets orientiert.
Sein Lebensweg bezeugt es von Jugend an. Der Großvater, ein Vorkämpfer des Bekenntnisses zur Urbevölkerung, hatte ihm die Geschichte und Literatur Mexikos nahegebracht. Der Vater, Freund und Anwalt des legendären Führers der Campesinos, der Kleinbauern, Emiliano Zapata, hatte an der mexikanischen Revolution teilgenommen. Octavio Paz veröffentlichte mit 14 Jahren seine ersten Gedichte. Im Alter von 17 Jahren gründete er die erste Literaturzeitschrift. Sein Studium brach er ab. Er wollte Autodidakt bleiben. Mit 23 Jahren zog er nach Yucatan, um eine Sekundärschule für die Kinder der Campesinos zu gründen. Hier begegneten ihm Elend, Armut und Größe der Eingeborenenkultur. 1937 zum Kongreß antifaschistischer Schriftsteller nach Madrid eingeladen, stand er im spanischen Bürgerkrieg auf republikanischer Seite. Alsbald verwahrte er sich gegen die Verwechslung des stalinistischen Kommunismus mit dem Sozialismus und erteilte jenem beim Hitler-Stalin-Pakt eine klare Absage. Nach längeren Aufenthalten in Paris und in den USA trat er in den diplomatischen Dienst seines Landes ein, der ihn nach Japan und später als Botschafter nach Indien führte. Als seine Regierung 1968, im Jahr der Olympiade und des Prager Frühlings, auf unbewaffnete Studenten schießen und ein Massaker anrichten ließ, verließ er sofort den Dienst. Für die Studenten in ganz Lateinamerika wurde er zum Symbol innerer Freiheit und moralischer Integrität. Später gründete er wieder Zeitschriften, zuletzt 1976 »Vuelta«, eine der anspruchsvollsten und einflußreichsten politischen und literarischen Zeitschriften der Welt.
Kritisch und undogmatisch, unabhängig und einsam bleibt er im Denken und im Verhalten. Er weiß, daß Kritik von sich aus weder Kunst noch Politik hervorbringt. Aber er glaubt daran, daß nur sie den physischen, sozialen und moralischen Raum zu schaffen vermag, in dem sich Kunst, Literatur und Politik entfalten.
Paz spricht solche Gedanken für Lateinamerika aus. Aber ich glaube nicht, daß unsere Erfahrungen geeignet wären, sie zu widerlegen.
Diesem kritischen Geist dient er, und um seinetwillen hält er Distanz zur Macht. Auch anderen gibt er denselben Rat: »Wenn der Philosoph an die Macht kommt, endet er entweder auf dem Schafott oder als gekrönter Tyrann.« Das ist eine strenge, gewiß wohlbegründete Empfehlung. Aber man sollte es auch nicht umgekehrt übertreiben. Ein Unglück wäre es jedenfalls nicht, wenn Politiker sich gelegentlich für Fragestellungen der Philosophie interessierten.
Octavio Paz ist auf seinem Weg zur prägenden Stimme lateinamerikanischer Kultur geworden, zu ihrem Gewissen.
- Durch ihn erfahren wir, wie sein eigenes Land und wie Lateinamerika um Identität ringen - ein politischer, sozialer und geistiger Prozeß von größter Bedeutung auch für uns. Paz beobachtet und gestaltet ihn zugleich.
- Wir begegnen in ihm dem kritischen Denker und Schriftsteller der Freiheit, der seinen Weg in unerbittlicher Unabhängigkeit und kosmopolitischer Einsamkeit geht.
- Seine tiefste Wirkung aber bezieht er aus seiner lyrischen Dichtung. Seine Poesie bereichert die Weltliteratur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wie nur wenige andere.
Paz ist ein Schriftsteller von außerordentlicher politischer Wirkung. Letzten Endes ist es aber weniger die Politik als die Geschichte, die ihn bewegt und die er als Geschichte der Kultur begreift.
In seinem berühmten »Labyrinth der Einsamkeit« und zahlreichen Essays macht Paz uns mit dieser Geschichte vertraut. Seit zwei Jahrhunderten, so sagt er, ringen die besten Lateinamerikaner um eine umfassende soziale, politische und geistige Reform. Modernisierung ist ihr Ziel. Aber so lang wie der Kampf, so lang ist die Reihe der Irrtümer über die geschichtliche Wirklichkeit. Schon die Vielzahl der Namen für den Kontinent verwirrt.
Welcher stimmt genau genug? Lateinamerika, Hispanoamerika, Iberoamerika, Indoamerika? Jeder Name bezeichnet und verschweigt zugleich einen Teil der Wirklichkeit. Was wir bei Paz über Lateinamerika erfahren, ist immer auch eine Auskunft über unsere eigene Geschichte. Er schildert die besondere Version christlich-abendländischer Kultur, die von der Iberischen Halbinsel nach Lateinamerika gekommen ist: die Verschmelzung des Religiösen mit dem Politischen, in deren spanischen Wesenszügen er Spuren des Islam entdeckt; die Identifizierung mit einem universalen, einer einzigen Auslegung zugänglichen Glauben; die Verweigerung der anbrechenden Modernität. Neben dem abendländischen Einfluß, den Paz stets ohne Ungerechtigkeit und ohne polemischen Fanatismus beschreibt, steht das Gewicht des starken Bevölkerungsanteils der Indios.
Paz schildert, wie sie die Sensibilität der Völker verfeinert und ihre Phantasie befruchtet haben. Vermischt mit den spanischen Einflüssen findet er die Merkmale ihrer Kultur in der Religion, den Märchen und Legenden, den Mythen, den Künsten, der Gesellschaftsmoral und der Küche seines Volkes. Den Weg in die Unabhängigkeit der lateinamerikanischen Völker sieht er begleitet vom immer neuen Scheitern am wichtigsten Ziel, nämlich an der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Modernisierung. Er beschreibt, wie nordamerikanische Vorbilder die Väter der lateinamerikanischen Unabhängigkeit und Liberalität beseelt haben. Als um so tragischer empfindet er es, daß dasselbe Nordamerika allzuoft zum Hindernis für die Modernisierung Lateinamerikas geworden ist, weil es inmitten der typischen Machtaufteilung zwischen wirtschaftlichen Oligarchien und Militärs mit falschen Verbündeten zusammengearbeitet und interveniert hat. Auch noch so häufige Militärputsche haben aber die geschichtliche Legitimität der Demokratie im Bewußtsein der lateinamerikanischen Völker nie in Frage gestellt: »Mit ihr«, so sagt er, »sind wir geboren, und trotz der Verbrechen und Tyranneien war die Demokratie für unsere Völker so etwas wie ein geschichtlicher Taufschein.« So oft auch die Demokratie entstellt und verraten worden ist, so ist doch all das Gute, das seit anderthalb Jahrhunderten in Lateinamerika gewachsen ist, im Zeichen der Demokratie oder, wie in Mexiko, auf die Demokratie hin geschaffen worden. Mit besorgter Aufmerksamkeit beobachtet Paz heute eine Revitalisierung alter politisch-religiöser Absolutheitsansprüche in neuer Form. Nunmehr wird geoffenbarte Wahrheit durch angebliche wissenschaftliche Wahrheit ersetzt, welche die Geschichte und Gesellschaft universal deutet und sich nicht mehr in einer Kirche, sondern in einer Partei verkörpert. »Eine paradoxe Modernität: Die Ideen sind von heute, das Verhalten ist von gestern. Ihre Großväter beriefen sich auf den Heiligen Thomas von Aquin, sie berufen sich auf Marx, aber für die einen wie die anderen ist die Vernunft eine Waffe im Dienst einer großgeschriebenen Wahrheit... Ihr Begriff von der Kultur und vom Denken impliziert Polemik und Kampf: sie sind Kreuzritter. So besteht in unseren Ländern eine geistige Tradition fort, welche die Meinung des anderen wenig achtet, welche die Ideen der Wirklichkeit und die geistigen Systeme der Kritik der Systeme vorzieht.«
Die Meinung des anderen zu achten, bedeutet nicht, jede Position zu relativieren. Kritik der Systeme wendet sich nicht gegen die Suche nach Wahrheit. Aber wer eigene Überzeugungen als Wahrheit absolut setzt und politisch instrumentalisiert, macht freies Zusammenleben von Menschen unmöglich.
An Zentralamerika liest Paz das Mißgeschick der ganzen Geschichte seines Kontinents ab. Unabhängigkeit führt zur Aufsplitterung, zur Vereinzelung, zur Schwäche. Die Folge davon ist wieder eine Krise der Unabhängigkeit und fremde Intervention. Unrecht und Elend dauern fort, »gleich wer der Gewinner ist, der Obrist oder der Guerillero«. Paz analysiert und kämpft für den Weg zur Demokratie in Lateinamerika. »Demokratie und Unabhängigkeit sind komplementäre und voneinander untrennbare Wirklichkeiten: Die erste verlieren, heißt die letztere verlieren und umgekehrt.« Erst wenn die Demokratie gewonnen ist, ist die Unabhängigkeit vollendet. In diesen Zusammenhang gehören die Gedanken von Paz zur Freiheit, die er aus seinem geistigen und politischen Verständnis von Kultur entfaltet. Er sieht in der Freiheit kein System allgemeiner Erklärungen und keine Philosophie. Denn »jeder von uns ist ein einzigartiges und besonderes Wesen«. »Die Freiheit gewährleistet mir meine Einzigartigkeit und löst sich in die Anerkennung des anderen und der anderen auf.« Paz knüpft an Rosa Luxemburg an. »Der andere ist zugleich Grenze und Quelle meiner Freiheit... Wenn Freiheit und Demokratie auch keine äquivalenten Begriffe sind, so sind sie doch komplementär: Ohne Freiheit ist die Demokratie Despotie, ohne Demokratie ist die Freiheit eine Schimäre.«
Erlauben Sie mir, aus den Schriften von Paz zur Freiheit noch einen Passus zu zitieren, mit dem er den Einfluß von Cervantes auf unsere Erfahrung mit Freiheit beschreibt: »Mit Cervantes beginnt die Kritik des Absoluten: Es beginnt die Freiheit. Und sie beginnt mit einem Lächeln, nicht der Freude, sondern des Wissens. Der Mensch ist ein prekäres, komplexes, doppeltes oder dreifaches Wesen, von Phantasmen heimgesucht, von Begierde getrieben, von Sehnsucht zernagt: ein prachtvolles und klägliches Schauspiel. Jeder Mensch ist ein einzigartiges Wesen, und jeder Mensch ist allen anderen ähnlich. Jeder Mensch ist einmalig, und jeder Mensch ist viele Menschen, die er nicht kennt: Das Ich ist pluralisch. Cervantes lächelt: Lernen, frei zu sein, heißt lernen zu lächeln.«
Großartig und eindrucksvoll an Paz' Gedanken zu Unabhängigkeit und Demokratie, zu Freiheit und Frieden ist, daß sie uns nie als abstrakte Ideenkritik begegnen. Sie sind vielmehr lebensvoll und glaubwürdig, weil sie im Leben und Denken von Octavio Paz ein natürlicher Bestandteil der ihn tief bewegenden Frage nach der nationalen Wesensart und nach Identität sind. Dieses zentrale Thema in Lateinamerika und zumal in Mexiko findet in Paz seinen großen Interpreten: »Der Mexikaner will weder Spanier noch Indio sein, ebensowenig will er von ihnen abstammen. Er leugnet sie, und er behauptet, weniger ein Mestize zu sein als dessen Abstraktion: ein Mensch. Er möchte von niemandem abstammen. Seinen Ursprung bei sich selber nehmen... Den Mexikaner und die Mexikanität kann man als Bruch und Verneinung definieren, aber auch als Suche und Willen, den Zustand der Isolierung zu überwinden, kurz, als lebendiges Bewußtsein der Einsamkeit, der geschichtlichen wie der persönlichen.«
»Mexiko hat«, so sagt Paz an anderer Stelle, »kein Bündel von universalen Ideen zu Verfügung, die unsere Situation rechtfertigen könnten. Aber auch Europa, dieses Magazin fertiger Ideen, lebt heute wie in den Tag hinein. Streng genommen, hat die ganze moderne Welt keine neuen Ideen. Deshalb ist sie, genau wie der Mexikaner, der Realität gegenüber einsam.«
Octavio Paz zu ehren, heißt nicht nur einen großen Geist, sondern seinen Kontinent zu ehren, der vielleicht als erster mit Würde die ganze Problematik einer identitätslosen Existenz des modernen Menschen durchkämpft. Lateinamerika, wie es uns in Paz begegnet, ist uns in diesem Ringen voraus, in der Desillusionierung an einem »Fortschritt«, welcher die eigentümlichen, geistigen Grundlagen eines Volkes und seines Lebens gefährdet.
Ein Mann vom Range Paz' macht uns deutlich, wie fruchtlos alle bewußten oder unbewußten Versuche einer geistigen Kolonialisierung gegenüber Lateinamerika geblieben sind. Lateinamerika sucht seinen eigenen Weg. Dazu muß es seine eigene Kraft entwickeln. Von welcher universalen Großidentität sollte es auch leben? In welcher technisch-wissenschaftlichen Großkultur sich wiederfinden? Welche Grundsätze des Internationalen Währungsfonds als eigene kulturelle Lebensregeln verstehen?
Die Mexikaner, vergewaltigt in der Geschichte, auf der Suche nach sich selbst, haben den Mut zur Eigentümlichkeit. Der Mensch findet zu sich selbst in seiner Kultur. Kultur ist Geschichte nicht von Ideen, sondern vom konkreten, je einmaligen Menschen.
Kultur ist für Paz keine »unbewegliche, stets mit sich selbst identische Wesenheit«, kein Wertekatalog, sondern Lebensweise. In dieser Kultur findet der Mensch Frieden mit sich. Er entwickelt die Fähigkeit zum friedlichen Zusammenleben. Paz gilt in seiner Heimat als pazifistischer Demokrat in des Wortes ureigenster Bedeutung, als ein Demokrat, der Frieden schafft für eine überschaubare Gemeinschaft von Menschen.
Auch wir sind unterwegs. Es gibt keine universale Modernität oder Identität, die wir uns selbst zu verkünden oder zu exportieren hätten. Wir suchen ständig unseren eigenen Weg der Kultur. Das ist entscheidend wichtig. Er darf uns nicht in eine Frontstellung gegen das technische Zeitalter treiben. Erst recht ist er kein unpolitischer Weg.
Aber er weist über Wissenschaft, Wirtschaft und Sicherheit hinaus. Es ist ein Weg, der in unseren eigenen, uns eigentümlichen geistigen Beziehungen gründet und der Politik Kontinuität gibt.
Kultur ist Politik. Kultur, verstanden als Lebensweise, ist vielleicht die glaubwürdigste, die beste Politik. Wieder können wir bei Paz lernen. Uns begegnet bei ihm ein Verständnis von Kultur, das uns aus der deutschen Geistesgeschichte wohlvertraut ist. Paz hat, entgegen einem ihm von Ortega y Gasset gegebenen Rat, nie Deutsch gelernt. Aber er bekennt sich zu prägenden Einflüssen durch die deutsche Philosophie und Literatur, vermittelt nicht zuletzt durch Ortega. Er spricht mit Bildern und Gedanken, die wir verstehen. »Nach Deutschland zu reisen, ist für mich eine Art von Jugenderfahrung, die ich nicht gelebt habe.« Wir können nicht dankbar genug sein, daß er gekommen ist und uns hilft, den Weg seines Denkens nachzuvollziehen. Er vertieft nicht nur unser Verständnis von Lateinamerika, sondern er hilft uns auch, unsere eigenen Aufgaben besser zu erkennen.
Paz verbindet viele fruchtbare geistige Tätigkeiten in einzigartiger Form. Sein Überblick über Kulturen und Literaturen der Welt mit Schwerpunkt in Indien, Japan, Europa und Nordamerika ist ohnegleichen. Er ist ein Vorbild der Unabhängigkeit und der Kraft des kritischen Denkens. Er ist zum Interpreten und Erzieher seines Volkes geworden. Zum tiefsten Kern der Dinge aber dringt er vor mit seiner Poesie. Seit seiner Jugend hat Paz den Aufruf zur Aktion und zur Kontemplation verspürt. Beiden ist er gefolgt. Die Brücke zwischen beiden hat er in der Poesie gefunden.
Die Poesie:
»Sie sagt,
was ich verschweige,
sie verschweigt,
was ich sage,
sie träumt,
was ich vergesse.
Sie ist nicht Sagen,
sie ist Tun.
...
Die Augen sprechen,
die Worte schauen,
die Blicke denken.«
Gewiß, auch in seinen großen Gedichten, so etwa in »Sonnenstein«, »Weiß« und im »Nachtstück von San Ildefonso« bleibt er verbunden mit den zentralen Themen, die uns bei ihm immer wieder begegnen. Er denkt nach über die Geschichte, das tragische Spiel der Irrungen in der historischen Zeit, über Schuld und Scheitern mit den Idealen der Gerechtigkeit, über Rationalismus und Humanität. Wieder begegnen wir seinen Gedanken über Identität, liberale Tradition und Ideologie. Aber wenn er dort meditiert über Geschichte, Kultur und den Menschen, dann geht er den entscheidenden Schritt weiter in Richtung auf Wahrheit. Wahrheit, wie Kultur, lebt für Paz nicht in der abstrakten Idee, sondern im konkreten Menschen. Kein Mensch besitzt und verfügt über die Wahrheit. Aber es gibt Augenblicke, in denen ihn die Wahrheit berührt. Dann wird er seiner selbst gewahr. Es ist der Augenblick der Erfahrung, der Erleuchtung, der Liebe, der Ekstase oder der ruhigen, inneren Gewißheit. Der Augenblick, der Widersprüche aufhebt, der Klarheit bringt, der den Menschen in unaussprechlicher Weise eins sein läßt mit dem Leben.
Wenn der Augenblick vorbei ist, kehren wir zurück zur Zeit mit ihren Widersprüchen, zurück an den Anfang eines Kreises, den wir wieder von neuem ausschreiten. Aber der Augenblick hat uns verwandelt (siehe Pere Gimferrer im Nachwort zu »Suche nach einer Mitte«).
Diesen Augenblick zu bannen, ist die Aufgabe des Gedichtes. Die Verse belagern den Augenblick, sie umzingeln ihn, da er uns unser wahres Wesen offenbaren wird.
So wird das Gedicht für Paz die »Pforte zum Augenblick, wo die Wahrheit wohnt". Die Dichtung dient der wesensmäßigen Einheit des Augenblicks, sie macht seine ewige Gegenwart erfahrbar:
Dichtung ist nicht Wahrheit.
Wahrheit ist nicht Geschichte.
In seinem »Nachtstück von San Ildefonso« sagt Octavio Paz:
» Die Wahrheit
ist der Grund der Zeit ohne Geschichte.
Das Gewicht
des Augenblicks ohne die Last der Wichtigkeit:
...
Die Dichtung,
wie die Geschichte, wird gemacht:
die Dichtung,
wie die Wahrheit, wird gesehen.
...
Die Dichtung,
Hängebrücke zwischen Geschichte und Wahrheit, ist nicht ein Weg zu dem oder jenem:
sie ist Schauen
der Ruhe in der Bewegung,
des Übergangs
in der Ruhe.
Die Geschichte ist der Weg:
er führt nirgendwohin,
wir alle beschreiten ihn,
die Wahrheit ist, ihn zu beschreiten.
Wir gehen nicht, wir kommen nicht:
wir sind in den Händen der Zeit.
Die Wahrheit:
uns zu wissen,
von Anfang an,
in der Schwebe,
Brüderlichkeit über der Leere.«
Große Gedichte der Weltliteratur! Wo gibt es Vergleichbares in unserer Zeit? Wo sind Verstand und lyrische Empfindung, wo Kopf und Herz so im Lot? Wir verdanken sie Lateinamerika. Und wir verdanken es dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels und dem hervorragenden Engagement von Verleger, Übersetzer, Interpreten und Kritikern, uns endlich für sie zu öffnen.
Paz geht seinen eigenen Weg. Er geht seinem eigenen Volk, den Mexikanern, voran. Er spricht für Lateinamerika. Dabei stößt er zum Kern des Lebens vor. Indem er es tut, verleugnet er nicht Zeit, Geschichte, Tradition, Geographie, Hautfarbe, soziale Befindlichkeit. Und doch überschreitet er sie zugleich.
Er denkt und fühlt, er spricht und dichtet auch für uns. Wie er begabt ist zum Leben und Zusammenleben, so dient er dem Frieden des Menschen mit dem Leben.
Dafür ehren wir Octavio Paz.
Wir ehren Mexiko.
Wir ehren Lateinamerika.
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck und jede andere Art der Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen, die urheberrechtlich nicht gestattet ist, werden verfolgt. Anfragen zur Nutzung der Reden oder von Ausschnitten daraus richten Sie bitte an: m.schult@boev.de
Richard von Weizsäcker
Laudatio
Der Dialog schließt das Ultimatum aus und ist so ein Verzicht auf das Absolute mit seinem despotischen Totalitätsanspruch: Wir sind relativ, und es ist relativ, was wir sagen und was wir hören. Aber diese Relativität impliziert keine Resignation: Damit der Dialog stattfindet, müssen wir bejahen, was wir sind, und zugleich den anderen in seiner unbeugsamen Andersheit anerkennen. Der Dialog verbietet uns, uns zu negieren und die Menschlichkeit unseres Gegners zu negieren.
Octavio Paz - Dankesrede
Octavio Paz
Friedenspreisträger 1984
Dankesrede
Als mein Freund Siegfried Unseld mir ankündigte, daß ich den Friedenspreis erhalten solle, den der Börsenverein des Deutschen Buchhandels jedes Jahr während der Frankfurter Buchmesse vergibt, war meine erste Reaktion ungläubige Dankbarkeit: Warum wohl hat man an mich gedacht? Nicht des fragwürdigen Werts meiner Schriften wegen, sondern wahrscheinlich wegen meiner obstinaten Liebe zur Literatur. Für alle Schriftsteller meiner Generation - ich bin im unseligen Jahr 1914 geboren - war der Krieg stetige, schreckliche Gegenwart. Ich habe zu schreiben begonnen - eine höchst geräuschlose Tätigkeit -gegenüber dem Lärm der Streitereien und Kämpfe unseres Jahrhunderts - und gegen ihn. Ich habe geschrieben und ich schreibe, weil ich die Literatur als einen Dialog mit der Welt, mit dem Leser und mit mir selbst verstehe - und der Dialog ist das Gegenteil sowohl des Lärms, der uns negiert, als auch des Schweigens, das uns ignoriert. Ich bin immer der Meinung gewesen, daß der Dichter nicht nur derjenige ist, der spricht, sondern auch jener, der zuhört.
Meine Ungläubigkeit, vermischt mit dem sehr realen und tiefen Gefühl der Dankbarkeit, die auszudrücken mir aus Furcht, sie könnte übertrieben erscheinen, nicht leicht fällt, hat sich noch verstärkt, Herr Präsident, als ich die Worte hörte, mit denen Sie meine Person und meine Schriften bedacht haben. Ich bin ehrlich bewegt; Sie waren sehr generös, und ich kann Ihnen darauf nur sagen, daß ich den Rest meines Lebens versuchen werde, mich Ihrer Worte würdig zu erweisen.
Der erste wirklich historische Bericht unserer religiösen Tradition ist die Geschichte der Ermordung Abels durch Kain. Mit dieser schrecklichen Begebenheit beginnt unser irdisches Leben; was im Garten Eden geschah, geschah vor der geschichtlichen Zeit. Mit dem Sündenfall wurden die beiden Kinder der Sünde und des Todes geboren: die Arbeit und der Krieg. Es begann die Verdammung, es begann die Geschichte. In den anderen religiösen Traditionen gibt es Berichte, die Ähnliches besagen. Insbesondere der Krieg wurde immer mit Schrecken gesehen, selbst bei jenen Völkern, die ihn als Ausdruck des Streits zwischen übernatürlichen Mächten oder kosmischen Prinzipien begreifen. Ihn fliehen heißt, unserer menschlichen Natur zu entrinnen, über uns selbst hinauszugehen oder, besser gesagt, wieder der zu werden, der wir vor dem Sündenfall waren. Darum zeigt uns die Tradition ein anderes Bild, die strahlende Kehrseite dieser düsteren Sicht des Menschen und seines Schicksals: Im Schoße der versöhnten Natur, unter einer gnädigen Sonne und mitleidigen Sternen leben Männer und Frauen in Muße, Frieden und Eintracht. Die natürliche Harmonie zwischen allen Lebewesen - Pflanzen, Tiere, Menschen - ist das sichtbare Bild der geistigen Harmonie. Der wahre Name dieser kosmischen Eintracht ist Liebe; ihr unmittelbarster Ausdruck ist die Unschuld: Männer und Frauen gehen nackt. Sie haben nichts zu verbergen, sie sind weder Feinde, noch fürchten sie einander: Die Eintracht ist die allgemeine Transparenz. Der Friede war eine Dimension der Unschuld des Anfangs, vor Beginn der Geschichte. Das Ende der geschichtlichen Zeit wird der Beginn des Friedens sein: das Reich der wiedererlangten Unschuld.
Viele philosophische und politische Utopien haben sich von dieser religiösen Vision inspirieren lassen. Wenn die Menschen vor der geschichtlichen Zeit gleich, frei und friedfertig waren, wann und wie begann das Übel? Wir können das nicht wissen, es ist jedoch zu vermuten, daß die blinde Bewegung, die wir Geschichte nennen, durch einen Akt der Gewalt ausgelöst wurde. Die Menschen hörten auf, frei und gleich zu sein, als sie sich einem Führer unterwarfen. Wenn der Anfang der Ungleichheit, der Unterdrückung und des Krieges die Herrschaft weniger über viele war, wie sollte man in der Macht nicht den Ursprung und die Ursache der Ungerechtigkeiten der Geschichte sehen? Nicht in der Macht dieses oder jenes Fürsten, der eine mild, der andere tyrannisch, sondern in dem Prinzip selbst und in der Institution, die es verkörpert: im Staat. Nur dessen Abschaffung könnte der Knechtschaft der Menschen und dem Krieg zwischen den Nationen ein Ende machen. Die Revolution wäre die große Wende der Geschichte oder, in religiösen Begriffen, die Wiederkehr der ursprünglichen Zeit: die Rückkehr zur Unschuld des Anfangs, in dessen Schoß die individuellen Freiheiten sich in gesellschaftliche Eintracht auflösen.
Die Verführungskraft dieser Idee - Verbindung der lautersten Moral mit Träumen, die von edelster Gesinnung zeugen - ist überaus groß gewesen. Zwei Gründe verbieten mir jedoch, diese optimistische Hypothese zu teilen. Der erste: Wir haben es mit einer unbewiesenen und, ich fürchte, nicht beweisbaren Annahme zu tun. Der zweite: Das Entstehen des Staates bedeutete mit großer Wahrscheinlichkeit nicht den Anfang, sondern das Ende des ewigen Krieges, der die primitiven Gemeinschaften heimsuchte. Für Marshall Sahlin, Pierre Clastres und andere zeitgenössische Anthropologen lebten die Menschen anfänglich frei und waren relativ gleich. Grundlage dieser Freiheit war ihre physische Kraft und der Überfluß an Gütern: Die Gesellschaft der »Wilden« war eine Gesellschaft freier und autarker Krieger. Und sie war eine egalitäre Gesellschaft, die leichte Verderblichkeit der Güter verhinderte deren Anhäufung. In jenen einfachen und isolierten Gemeinschaften waren die gesellschaftlichen Bande äußerst zerbrechlich, und die permanente Wirklichkeit war die Zwietracht: der Krieg aller gegen alle. Bereits zu Beginn der Neuzeit hatten die spanischen neuthomistischen Theologen die Meinung vertreten, daß die Menschen anfänglich frei und gleich waren - status naturae -, doch daß sie mangels einer politischen Organisation (eines Staates) isoliert lebten und wehrlos waren, der Gewalt, der Ungerechtigkeit und der Dispersion ausgesetzt. Der status naturae war nicht gleichbedeutend mit Unschuld: Die Menschen der Vorzeit waren wie wir nicht im Stande der Unschuld. Hobbes ging noch weiter und sah im Naturzustand nicht das Bild der Eintracht und Freiheit, sondern das der Ungerechtigkeit und Gewalt. Der Staat entstand, um die Menschen vor den Menschen zu schützen.
Wenn die Abschaffung des Staates dazu führen würde, daß wir zur ständigen Zwietracht untereinander zurückkehren, wie dann den Krieg vermeiden? Seitdem es Staaten gibt auf der Erde, bekämpfen sie sich. Es ist daher nicht verwunderlich, daß das Streben nach dem Weltfrieden bisweilen verwechselt worden ist mit dem Traum von einem weltumfassenden Staat ohne Rivalen. Dieses Ideal ist ebensowenig zu verwirklichen wie die Abschaffung des Staates und vielleicht noch gefährlicher. Der Friede, der dadurch entsteht, daß allen Nationen ein einziger Wille aufgezwungen wird, und wäre dieser auch der Wille des unpersönlichen Gesetzes, würde bald zu Einförmigkeit und Wiederholung, Masken der Sterilität entarten. Während die Abschaffung des Staates uns zum ständigen Krieg zwischen den Parteien und Individuen verdammen würde, würde die Gründung eines einzigen Staates zu weltweiter Knechtschaft und zum Tod des Geistes führen. Zum Glück hat die geschichtliche Erfahrung dieses Trugbild immer wieder verscheucht. Es gibt keine Beispiele für eine geschichtliche Gesellschaft ohne Staat; dagegen gibt es Beispiele, und deren viele, für große Imperien, die nach der Weltherrschaft gestrebt haben. Das Schicksal aller großen Reiche lehrt uns, daß dieser Traum nicht nur nicht zu verwirklichen, sondern darüber hinaus auch unheilvoll ist. Unheilvoll ist bereits das Entstehen der Imperien: die Eroberung und die Ausplünderung; und auch ihr Ende ist es: der Zerfall, die Aufteilung. Die Imperien sind zur Zersplitterung verurteilt wie die Orthodoxien und die Ideologien zur Spaltung.
Der Staat hat eine doppelte, eine widersprüchliche Funktion: Er bewahrt den Frieden und entfesselt den Krieg. Diese Ambivalenz ist die aller Menschen. Individuen, Gruppen, Klassen, Nationen und Regierungen, alle sind wir zur Divergenz, zur Auseinandersetzung und zum Streit verurteilt; aber wir sind auch zum Dialog und zum Verhandeln verurteilt. Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen der zivilen Gesellschaft der Individuen und Gruppen und der internationalen Gesellschaft der Staaten. In der ersteren werden die Kontroversen durch den gegenseitigen guten Willen der streitenden Parteien oder durch die Autorität des Gesetzes und der Regierung geschlichtet; in der letzteren ist das einzige, was wirklich zählt, der Wille der Regierungen. Eben die Natur der internationalen Gesellschaft verhindert die Existenz einer effektiven überstaatlichen Gewalt. Weder die Vereinten Nationen noch die anderen internationalen Organisationen verfügen über die notwendige Macht, den Frieden zu bewahren oder die Aggressoren zu bestrafen; sie sind beratende Versammlungen, nützlich, um zu verhandeln, aber sie haben den Nachteil, daß sie leicht zur Bühne von Propagandisten und Demagogen werden.
Die Macht, Krieg oder Frieden zu machen, liegt im wesentlichen bei den Regierungen. Allerdings ist es keine unumschränkte Macht: Selbst Diktatoren müssen, bevor sie einen Krieg entfesseln, in höherem oder minderem Maße die Meinung und das Empfinden des Volkes in Rechnung ziehen. In den offenen, demokratischen Gesellschaften, in denen die Regierungen über ihr Handeln periodisch Rechenschaft geben müssen und in denen es eine legale Opposition gibt, ist es schwieriger, eine Kriegspolitik zu betreiben. Kant sagte, daß die Monarchien mehr zum Krieg neigen als die Republiken, da in den ersteren der Souverän den Staat als sein Eigentum betrachtet. Freilich ist die demokratische Staatsform allein noch keine Garantie für den Frieden, was unter anderen das Athen von Perikles oder das Frankreich der Revolution beweisen. Wie die anderen politischen Systeme ist auch die Demokratie dem unheilvollen Einfluß der Nationalismen und anderer militanter Ideologien ausgesetzt. Trotzdem ist die Überlegenheit der Demokratie auf diesem Gebiet, wie auf vielen anderen, für mich unleugbar: Krieg und Frieden sind Dinge, über die unsere Meinung zu äußern wir alle nicht nur das Recht, sondern die Pflicht haben.
Ich habe von dem widrigen Einfluß gesprochen, den die nationalistischen, intoleranten und exklusivistischen Ideologien auf den Frieden gehabt haben. Diese Ideologien sind noch weit schädlicher, wenn sie aufhören, die Glaubensanschauung einer Sekte oder einer Partei zu sein und zur institutionellen Doktrin einer Kirche oder eines Staates werden. Das Streben nach dem Absoluten - immer unerreichbar - ist eine edle Leidenschaft, doch der Glaube, wir seien im Besitz der absoluten Wahrheit, degradiert uns: In jedem Menschen, der anders denkt als wir, sehen wir ein Ungeheuer und eine Gefahr, und so werden wir selber zu Ungeheuern und zu Gefahren für unseresgleichen. Wenn unsere Glaubensanschauung zum Dogma einer Kirche oder eines Staates wird, werden jene, die ihr nicht anhängen, abscheuliche Ausnahmen: Sie sind die anderen, die Andersgläubigen, die man bekehren oder vernichten muß. Und zuletzt: Wenn Kirche und Staat miteinander verschmelzen, wie das in früheren Zeiten der Fall war, oder wenn ein Staat sich selbst zum Eigentümer der Wissenschaft und der Geschichte proklamiert, wie das im 20. Jahrhundert geschieht, dann tauchen sofort die Ideen des Kreuzzugs, des heiligen Krieges und ihrer modernen Entsprechungen wie die des revolutionären Krieges auf. Die ideologischen Staaten sind ihrem Wesen nach kriegerisch. Und sie sind es in zweifacher Hinsicht; durch die Intoleranz ihrer Doktrinen und durch die militärische Disziplin ihrer Eliten und Führungsspitzen. Eine widernatürliche Verbindung von Kloster und Kaserne.
Die Proselytenmacherei, fast immer verbunden mit militärischer Eroberung, war ein Charakteristikum der ideologischen Staaten von der Antike bis heute. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde durch die Kombination politischer und militärischer Maßnahmen die Eingliederung der Völker des (fälschlich) sogenannten Osteuropa in das totalitäre System vollzogen. Den Nationen des Westens schien das gleiche Los beschieden. Doch dem war nicht so: Sie haben standgehalten. Gleichzeitig jedoch sind sie unbeweglich geworden: Auf ihre unvergleichliche materielle Prosperität folgte weder eine geistige und kulturelle Wiedergeburt noch eine zugleich phantasievolle und energische, generöse und wirksame politische Tat. Es muß leider gesagt werden: Die großen demokratischen Nationen des Westens haben aufgehört, das Vorbild und die Inspirationsquelle der Eliten und Minderheiten der anderen Völker zu sein. Der Schaden für die ganze Welt war unermeßlich, insbesondere für die Nationen Lateinamerikas: Am geschichtlichen Horizont dieses zu Ende gehenden Jahrhunderts hat nichts den fruchtbaren Einfluß ersetzen können, den die europäische Kultur seit dem 18. Jahrhundert auf das Denken, die Sensibilität und die Imagination unserer besten Schriftsteller, Künstler und gesellschaftlicher und politischer Erneuerer ausgeübt hat.
Die Unbeweglichkeit ist ein besorgniserregendes Symptom, und sie wird beängstigend, sobald man erkennt, daß sie lediglich die Folge des nuklearen Gleichgewichts ist. Der Friede spiegelt nicht die Eintracht zwischen den Mächten wider, sondern ihre Furcht voreinander. Die Länder des Westens und des Ostens scheinen zur Unbeweglichkeit oder zur Vernichtung verdammt. Der Schrecken hat uns bisher vor der großen Katastrophe bewahrt. Aber wir sind Armageddon entgangen, nicht dem Krieg: Seit 1945 ist nicht ein Tag vergangen ohne Kämpfe in Asien oder Afrika, in Lateinamerika oder im Nahen und Mittleren Osten. Der Krieg wandert heute von einem Gebiet in ein anderes. Obgleich es nicht meine Absicht ist, auf diese Konflikte im einzelnen einzugehen, muß ich eine Ausnahme machen und von dem Fall Zentralamerika sprechen. Er geht mich besonders an, und er schmerzt mich; außerdem ist es dringend notwendig, die manichäischen Simplifikationen von Vertretern entgegengesetzter Meinungen zu beseitigen. Auf der einen Seite herrscht die Neigung, das Problem als ein bloße Episode der Rivalität zwischen den beiden Supermächten zu sehen; auf der anderen die, es auf einen lokalen Streit ohne internationale Verflechtungen zu reduzieren. Es ist klar, daß die Vereinigten Staaten bewaffnete Gruppen, die Gegner der Regierung von Managua sind, unterstützen; es ist klar, daß die Sowjetunion und Kuba den Sandinisten Waffen und Militärberater schicken; aber es ist auch klar, daß die Wurzeln des Konflikts tief in die Vergangenheit Zentralamerikas reichen.
Die Unabhängigkeit Spanisch-Amerikas (Brasilien ist ein anderer Fall) führte zur Zersplitterung des ehemals spanischen Reiches. Diesem Phänomen kommt eine andere Bedeutung zu als der nordamerikanischen Unabhängigkeit. Noch heute müssen wir für die Folgen dieser Zersplitterung bezahlen: im Innern chaotische Demokratien, gefolgt von Diktaturen, und nach außen hin Schwäche. Diese Übel haben in Zentralamerika Schwären gebildet: mehrere kleine Länder ohne klare nationale Identität (was unterscheidet einen Salvadorianer von einem Honduraner oder einem Nicaraguaner?), ohne große wirtschaftliche Lebensfähigkeit und der Begehrlichkeit von außen ausgesetzt. Obgleich die fünf Länder - Panama wurde erst später erfunden - die republikanische Staatsform wählten, gelang es keinem, das Musterland Costa Rica ausgenommen, eine echte und dauerhafte Demokratie einzuführen. Die Völker Zentralamerikas wurden schon bald Opfer der endemischen Krankheit unserer Länder: des militärischen Caudillotums. Der Einfluß der Vereinigten Staaten begann Mitte des vergangenen Jahrhunderts und nahm schon bald hegemonische Formen an. Die Vereinigten Staaten haben weder die Zerstückelung noch die Oligarchien noch die komischen und blutgierigen Diktatoren erfunden, aber sie haben sich diese Situation zunutze gemacht, haben die Regime der Gewaltherrscher gefestigt und entscheidend zur Korruption des politischen Lebens in Zentralamerika beigetragen. Ihre historische Verantwortung ist unleugbar, und ihre gegenwärtigen Schwierigkeiten in dieser Region sind die Folge ihrer Politik.
Im Schatten Washingtons entstand und erstarkte in Nicaragua eine erbliche Diktatur. Nach vielen Jahren führte die Verbindung verschiedener Umstände - die allgemeine Erbitterung, das Entstehen einer neuen, gebildeten Mittelklasse, der Einfluß einer erneuerten katholischen Kirche, die inneren Zwiste der Oligarchie und schließlich die Einstellung der nordamerikanischen Hilfe - zu einem Volksaufstand. Die Erhebung war national und stürzte die Diktatur. Kurz nach dem Sieg wiederholte sich der Fall Kuba: Eine Elite revolutionärer Führer nahm die Revolution für sich allein in Anspruch. Fast alle von ihnen entstammen der einheimischen Oligarchie, und die meisten sind vom Katholizismus zum Marxismus-Leninismus übergewechselt oder haben aus beiden Doktrinen einen absonderlichen Mischmasch gemacht. Von Anfang an haben die Führer des Sandinismus in Kuba Anregungen gesucht, und sie erhielten von der Sowjetunion und deren Verbündeten militärische und technische Hilfe. Das Handeln der sandinistischen Regierung zeugt von ihrem Willen, in Nicaragua eine militärbürokratische Diktatur nach dem Vorbild Havannas zu errichten. Auf diese Weise wurde der ursprüngliche Sinn der revolutionären Bewegung verfälscht.
Die Opposition ist nicht homogen. Im Innern ist sie sehr groß, aber sie verfügt über keine Medien, um sich zu äußern (in Nicaragua gibt es nur eine unabhängige Zeitung: »La Prensa«). Eine andere bedeutende Gruppe der Opposition lebt isoliert in unwirtlichen Regionen: die indigene Minderheit, die nicht spanisch spricht, die ihre Kultur und ihre Lebensformen bedroht sieht und unter der sandinistischen Herrschaft Beraubungen und Überfälle erlebt hat. Auch die bewaffnete Opposition ist nicht homogen: Einige sind konservativ (unter ihnen ehemalige Anhänger Somozas), andere sind demokratische Dissidenten des Sandinismus, und wieder andere gehören der indigenen Minderheit an. Keine dieser Gruppen will die Restauration der Diktatur. Die Regierung der Vereinigten Staaten gewährt ihnen militärische und technische Hilfe, obgleich bekanntlich diese Unterstützung im Senat und in weiten Kreisen der nordamerikanischen Öffentlichkeit auf wachsende Kritik stößt.
Ich muß schließlich die diplomatische Aktion der vier Länder erwähnen, die die sogenannte Contadora-Gruppe bilden: Mexiko, Venezuela, Kolumbien und Panama. Sie ist die einzige Gruppe, die eine Politik der Vernunft vorschlägt, eine Politik, die wirklich den Frieden zum Ziel hat. Die Bemühungen der vier Länder sind darauf gerichtet, die Bedingungen dafür zu schaffen, daß die Interventionen fremder Staaten aufhören und die streitenden Parteien die Waffen niederlegen und in Frieden miteinander verhandeln. Dies ist der erste Schritt und der schwierigste. Aber er ist unerläßlich: Die andere Lösung - der militärische Sieg der einen oder der anderen Seite - wäre nur der Same eines neuen, noch schrecklicheren Konflikts. Ich möchte noch darauf hinweisen, daß Friede in dem Gebiet erst dann tatsächlich wird wiederhergestellt werden können, wenn es dem Volk von Nicaragua möglich ist, in wirklich freien Wahlen, an denen alle Parteien teilnehmen, seine Meinung zu äußern. Diese Wahlen würden es erlauben, eine nationale Regierung zu bilden. Allerdings ist es mit Wahlen, obwohl sie notwendig sind, allein nicht getan. Auch wenn sich die Rechtmäßigkeit der Regierungen in unserer Zeit auf das allgemeine, freie und geheime Wahlrecht gründet, müssen weitere Bedingungen erfüllt werden, damit eine Regierung es verdient, demokratisch genannt zu werden: Gewährleistung der individuellen und gemeinschaftlichen Freiheiten und Rechte, Pluralismus und schließlich Respektierung der einzelnen Personen und der Minderheiten. Letzteres ist unabdingbar in einem Land wie Nicaragua, das lange Perioden des Despotismus erlebt hat und in dem mehrere rassische, religiöse, kulturelle und sprachliche Minderheiten zusammenleben.
Viele werden diesen Plan für unrealistisch halten. Er ist es nicht: El Salvador hat mitten im Bürgerkrieg Wahlen abgehalten. Trotz der terroristischen Methoden der Guerilleros, die die Leute einschüchtern wollten, damit sie nicht zur Wahl gingen, hat der überwiegende Teil der Bevölkerung friedlich gewählt. Es ist das zweite Mal, daß El Salvador Wahlen abgehalten hat (die ersten fanden 1982 statt), und beide Male war die hohe Wahlbeteiligung ein bewundernswertes Beispiel für die Berufung dieses Volkes zur Demokratie und für seinen Bürgersinn. Die Wahlen in El Salvador waren eine Verurteilung der doppelten Gewalt, die diese Nationen heimsucht: die der Rechtsextremisten und die der Guerrilleros der äußersten Linken. Man kann nicht mehr behaupten, daß dieses Land für die Demokratie nicht vorbereitet sei. Wenn die politische Freiheit für die Salvadorianer kein Luxus, sondern eine lebenswichtige Frage ist, warum dann nicht auch für das Volk von Nicaragua? Die Schriftsteller, die Manifeste zugunsten der sandinistischen Regierung veröffentlichen: haben sie sich diese Frage gestellt? Warum billigen sie in Nicaragua die Einführung eines Systems, das sie in ihrem eigenen Land für unerträglich halten würden? Warum ist das, was hier verhaßt wäre, dort bewundernswert?
Dieser Exkurs über Zentralamerika - vielleicht etwas lang: verzeihen Sie mir bitte - bestätigt, daß die Verteidigung des Friedens verbunden ist mit der Bewahrung der Demokratie. Ich betone nochmals, daß ich zwischen Demokratie und Frieden keine Beziehung von Ursache und Wirkung sehe: Mehr als einmal sind Demokratien kriegerisch gewesen. Aber ich glaube, daß die demokratische Staatsform uns einen Raum erschließt, der der Diskussion der öffentlichen Angelegenheiten und mithin der Themen Krieg und Frieden förderlich ist. Die großen gewaltfreien Bewegungen der unmittelbaren Vergangenheit - die größten Beispiele sind Gandhi und Martin Luther King - entstanden und entwickelten sich mitten in demokratischen Gesellschaften. Die pazifistischen Demonstrationen in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten wären in den totalitären Ländern undenkbar und unmöglich. Es ist daher sowohl ein logischer und politischer Fehler als auch ein Mangel an Moral, den Frieden von der Demokratie zu trennen.
Alle diese Überlegungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: Der einfachste und wesentlichste Ausdruck der Demokratie ist der Dialog, und der Dialog öffnet die Türen des Friedens. Nur wenn wir die Demokratie verteidigen, wird es uns möglich sein, den Frieden zu bewahren. Von diesem Prinzip leiten sich, meiner Meinung nach, drei weitere ab. Das erste: Unablässig den Dialog mit dem Gegner suchen. Dieser Dialog erfordert Standhaftigkeit und Nachgiebigkeit, Flexibilität und Festigkeit zugleich. Das zweite: Weder der Versuchung des Nihilismus erliegen noch sich durch den Terror einschüchtern lassen. Die Freiheit gibt es nicht vor dem Frieden, aber auch nicht nach ihm: Frieden und Freiheit sind unauflöslich miteinander verbunden. Sie voneinander trennen heißt, der Erpressung des Totalitarismus erliegen und am Ende das eine wie das andere verlieren. Das dritte: Erkennen, daß die Verteidigung der Demokratie in unserem eigenen Land untrennbar ist von der Solidarität mit jenen, die in den totalitären Ländern oder unter den Gewaltherrschaften und Militärdiktaturen in Lateinamerika und anderen Kontinenten für sie kämpfen. Indem die Dissidenten für die Demokratie kämpfen, kämpfen sie für den Frieden - kämpfen sie für uns.
In einem der Entwürfe Hölderlins zu einer Hymne, die eben der Feier des Friedens gewidmet ist und zu der Heidegger einen berühmten Kommentar geschrieben hat, sagt der Dichter, daß wir Menschen gelernt haben, das Göttliche und die geheimen Kräfte des Universums zu nennen,
Seit ein Gespräch wir sind
Und hören können voneinander.
Hölderlin versteht die Geschichte als Dialog. Jedoch wurde dieser Dialog durch den Lärm der Gewalt und durch den Monolog der Führer immer wieder unterbrochen. Die Gewalt vergrößert die Differenzen und hindert die einen wie die anderen daran, zu sprechen und zu hören; der Monolog negiert den anderen; der Dialog hebt die Unterschiede zwar nicht auf, aber er schafft eine Zone, in der Andersartiges nebeneinander besteht und sich verwebt. Der Dialog schließt das Ultimatum aus und ist so ein Verzicht auf das Absolute mit seinem despotischen Totalitätsanspruch: Wir sind relativ, und es ist relativ, was wir sagen und was wir hören. Aber diese Relativität impliziert keine Resignation: Damit der Dialog stattfindet, müssen wir bejahen, was wir sind, und zugleich den anderen in seiner unbeugsamen Andersheit anerkennen. Der Dialog verbietet uns, uns zu negieren und die Menschlichkeit unseres Gegners zu negieren. Marc Aurel hat einen Großteil seines Lebens zu Pferde zugebracht, im Krieg gegen die Feinde Roms. Er kannte den Kampf, nicht den Haß, und er hat uns die folgenden Worte hinterlassen, über die wir immer wieder nachdenken sollten: »Sobald der Tag anbricht, soll man sich sagen: Ich werde zusammentreffen mit einem taktlosen, einem undankbaren, einem niederträchtigen, einem zornmütigen Menschen ... Ich kenne seine Natur: er ist einer meines Geschlechts, nicht weil wir gleichen Bluts sind oder derselben Familie angehören, sondern weil wir Geist und göttlichen Anteil gemein haben. Wir sind zum Zusammenwirken geboren wie die Füße, die Hände, die Augen, die Lider, die Reihe der oberen und der unteren Zähne.« Der Dialog ist nur eine der Formen, vielleicht die höchste, der kosmischen Harmonie.
Aus dem Spanischen von Rudolf Wittkopf.
Original Spanisch
Cuando mi amigo Siegfried Unseld me anunció que se me concedería el Premio de la Paz que cada año otorga la Asociación de Editores y Libreros durante la Feria del Libro de Francfort, mi primera reacción fue de incrédulo agrade-cimiento: ¿por qué habrían pensado en mí? No por los dudosos méritos de mis escritos sino, tal vez, por mi obstinado amor a la literatura. Para todos los escritores de mi generación - nací en 1914, el año fatídico - la guerra ha sido una presencia constante y terrible. Comencé a escribir, operación silenciosa entre todas, frente y contra el ruido de las disputas y peleas de nuestro siglo. Escribí y escribo porque concibo a la literatura como un diálogo con el mundo, con el lector y conmigo mismo - y el diálogo es lo contrario del ruido que nos niega y del silencio que nos ignora. Siempre he pensado que el poeta no sólo es el que habla sino el que oye.
Mi incredulidad, mezclada con un sentimiento muy real y muy hondo de gratitud que no me es fácil expresar por miedo a que parezca exagerado, se ha multiplicado, Señor Presidente, cuando he oído los términos en que usted se ha referido a mi persona y a mis escritos. Estoy de veras conmovido; ha sido usted muy generoso y lo único que puedo decirle es que procuraré ser digno, en lo que me quede de vida, de sus palabras.
El primer relato propiamente histórico de nuestra tradidón religlosa es el episodio del asesinato de Abel por Caín. Con este terrible acontecimiento comienza nuestra existencia terrestre; lo que ocurrió en el Edén, ocurrió antes de la historia. Con la Caída aparecieron los dos hijos del pecado y la muerte: el trabajo y la guerra. Comenzó entonces la condena, comenzó la historia. En las otras tradiciones religiosas figuran relatos de significado semejante. La guerra, especialmente, ha sido siempre vista con horror, incluso entre aquellos pueblos que la juzgan una expresión de la contienda entre poderes sobrenaturales o entre principios cósmicos. Escapar de ella es escapar de nuestra condición, ir más allá de nosotros mismos o, mejor dicho, regresar a lo que fuimos antes de la Caída. Por esto la tradición nos presenta otra imagen, reverso radiante de esta visión negra del hombre y de su destino: en el seno de la naturaleza reconciliada, bajo un sol benévolo y unas constelaciones compasivas, hombres y mujeres viven en el ocio, la paz y la concordia. La armonía natural entre todos los seres vivos - plantas, animales, hombres - es la imagen visible de la armonía espiritual. El verdadero nombre de esta concordia cósmica es amor; su manifestación más inmediata es la inocencia: los hombres y las mujeres andan desnudos.
Nada tienen que ocultar, no son enemigos ni se temen: la concordia es la transparencia universal. La paz fue una dimensión de la inocencia del principio, antes de la historia. El fin de la historia será el comienzo de la paz: el reino de la inocencia recobrada.
Muchas utopías filosóficas y políticas se han inspirado en esta visión religiosa. Si antes de la historia los hombres eran iguales, libres y pacíficos: ¿cuando y cómo comenzó el mal? Aunque es imposible saberlo, no lo es presumir que un acto de violencia desencadenó el ciego movimiento que llamamos historia. Los hombres dejaron de ser libres e iguales cuando se sometieron a un jefe. Si el comienzo de la desigualdad, la opresión y la guerra fue la dominación de los pocos sobre los muchos, ¿cómo no ver en la autoridad al origen y la causa de las iniquidades de la historia? No en la autoridad de éste o aquel príncipe, uno piadoso y otro tiránico, sino en el principio mismo y en la institución que lo encarna: el Estado. Sólo su abolición podría acabar con la servidumbre de los hombres y con la guerra entre las naciones. La revolución sería la gran revuelta de la historia o, en términos religiosos, la vuelta de los tiempos del origen: el regreso a la inocencia del comienzo, en cuyo seno las libertades individuales se resuelven en concordia social.
El poder de seducción de esta idea - alianza de la moral más pura y de los sueños más generosos - ha sido inmenso. Dos razones, sin embargo, me prohiben compartir esta hipótesis optimista. La primera: estamos ante una suposición inverificada y, me temo, inverificable. La segunda: el nacimiento del Estado, muy probablemente, no significó el comienzo sino el fin de la guerra perpetua que aflijía a las comunidades primitivas. Para Marshall Sahlin, Pierre Clastres y otros antropólogos contemporáneos, en el comienzo los hombres vivían libres y relativamente iguales. El fundamento de esa libertad era la fuerza de su brazo y la abundancia de bienes: la sociedad de los salvajes era una sociedad de guerreros libres y autosuficientes. También era una sociedad igualitaria: la naturaleza perecedera de los bienes impedía su acumulación. En aquellas comunidades simples y aisladas los lazos sociales eran extremadamente frágiles y la realidad permanente era la discordia: la guerra de todos contra todos. Ya en los albores de la Edad Moderna los teólogos neotomistas españoles habían sostenido que, en el principio, los hombres eran libres e iguales - Status naturae - pero que, como carecían de organización política (Estado), vivían aislados, indefensos y expuestos a la violencia, la injusticia y la dispersión. El Status naturae no era sinónimo de inocencia: los hombres del comienzo eran, como nosotros, naturaleza caída. Hobbes fue más allá y vió en el estado de naturaleza no a la imagen de la concordia y la libenad sino a la de la injusticia y la violencia. El Estado nació para defender a los hombres de los hombres.
Si la abolición des Estado nos haría regresar a la discordia civil perpetua, ¿cómo evitar la guerra? Desde su aparición sobre la tierra, los Estados combaten entre ellos. No es extraño, así, que la aspiración hacia la paz universal se haya confundido a veces con el sueño de un Estado universal y sin rivales. El remedio no es menos irrealizable que el de la supresión del Estado y quizá sea más peligroso. La paz que resultaría de la imposición de la misma voluntad sobre todas las naciones, incluso si esa voluntad fuese la de la ley impersonal, no tardaría en degenerar en uniformidad y repetición, máscaras de la esterilidad. Mientras la abolición del Estado nos condenaría a la guerra perpetua entre las facciones y los individuos, la fundación de un Estado único se traduciría en la servidumbre universal y en la muerte del espíritu. Por fortuna, la experiencia histórica ha disipado una y otra vez esta quimera. No hay ejemplos de una sociedad histórica sin Estado; sí hay, y muchos, de grandes imperios que han perseguido la dominación universal. La suerte de todos los grandes imperios nos avisa que ese sueño no sólo es irrealizable sino, sobre todo, funesto. El comienzo de los imperios es semejante: la conquista y la expoliación: su fin también lo es: la disgregación, la desmembración. Los imperios están condenados a la dispersión como las ortodoxias y las ideologías a los cismas y a las escisiones. La función del Estado es doble y contradictoria: preserva la paz y desata la guerra. Esta ambiguedad es la de los seres humanos. Individuos, grupos, clases, naciones y gobiernos, todos, estamos condenados a la divergencia, la disputa y la querella; también estamos condenados al diálogo y a la negociación. Hay una diferencia, sin embargo, entre la sociedad civil compuesta por individuos y grupos y la sociedad internacional de los Estados. En la primera, las controversias se resuelven por la voluntad mutua de los querellantes o por la autoridad de la ley y del gobierno; en la segunda, lo único que cuenta realmente es la voluntad de los gobiernos. La naturaleza misma de la sociedad internacional impide la existencia de una autoridad superestatal efectiva. Ni las Naciones Unidas ni los otros órganos internacionales disponen de la fuerza necesaria para preservar la paz o para castigar a los agresores; son asambleas deliberativas, útiles para negociar pero que tienen el defecto de convertirse fácilmente en teatro de propagandistas y demagogos.
El poder de hacer la guerra o la paz compete esencialmente a los gobiernos. Cierto, no es un poder absolute: aún las tiranías, antes de lanzarse a una guerra, deben contar en mayor o menor grado con la opinión y el sentimiento popular. En las sociedades abiertas y democráticas, en las que los gobiernos deben dar cuenta periódicamente de sus actos y en las que existe una oposición legal, es más difícil llevar a cabo una política guerrera. Kant dijo que las monarquías son más propensas a la guerra que las repúblicas pues en las primeras el soberano considera al Estado como su propiedad. Naturalmente, por si sólo el régimen democrático no es una garantía de paz, según lo prueban, entre otros, la Atenas de Péricles y la Francia de la Revolución. La democracia está expuesta como los otros sistemas políticos a la influencia nefasta de los nacionalismos y las otras ideologías violentas. Sin embargo, la superioridad de la democracia en esta materia, como en tantas otras, para mí es irrefutable: la guerra y la paz son asuntos sobre los que todos tenemos no sólo el derecho sino el deber de opinar.
He mencionado la influencia adversa de las ideologías nacionalistas, intolerantes y exclusivistas sobre la paz. Su malignidad se multiplica cuando dejan de ser la creencia de una secta o de un partido y se instituyen en la doctrina de una Iglesia o de un Estado. La aspiración hacia lo absoluto - siempre inalcanzable - es una pasión sublime pero creernos dueños de la verdad absoluta nos degrada: vemos en cada ser que piensa de una manera distinta a la nuestra un monstruo y una amenaza y así nos convertimos, nosotros mismos, en monstruos y en amenazas de nuestros semejantes. Si nuestra creencia se convierte en el dogma de una Iglesia o de un Estado, los extraños se vuelven excepciones abominables: son los otros, los heterodoxos, a los que hay que convertir o exterminar. Por último, si hay fusión entre la Iglesia y el Estado, como ocurrió en otras épocas, o si un Estado se autoproclama el propietario de la ciencia y la historia, como sucede en el siglo XX, aparecen inmediatamente las nociones de cruzada, guerra santa y sus equivalentes modernos, como la guerra revolucionaria. Los Estados ideológicos son por naturaleza belicosos. Lo son por partida doble: por la intolerancia de sus doctrinas y por la disciplina militar de sus élites y grupos dirigentes. Nupcias contranaturales del convento y el curatel.
El proselitismo, casi siempre aunado a la conquista militar, ha caracterizado a los Estados ideológicos desde la Antiguedad hasta nuestros días. Después de la segunda guerra, por medios conjuntamente políticos y militares, se consumó la incorporación al sistema totalitario de los pueblos de la llamada (impropiamente) Europa del Este. Las naciones de Occidente parecían destinadas al mismo destino. No ha sido así: han resistido. Pero, al mismo tiempo, se han inmovilizado: a su prosperidad material sin paralelo no ha seguido - ni un renacimiento moral y cultural ni una acción política a la vez imaginativa y enérgica, generosa y eficaz. Hay que decirlo: las grandes naciones democráticas de Occidente han dejado de ser el modelo y la inspiración de las élites y las minorías de los otros pueblos. La pérdida ha sido enorme para todo el mundo y muy especialmente para las naciones de América Latina: nada en el horizonte histórico de este fin de siglo ha podido substituir a la influencia fecunda que, desde el siglo XVIII, ha ejercido la cultura europea sobre el pensamiento, la sensibilidad y la imaginación de nuestros mejores escritores, artistas y reformadores sociales y políticos.
La inmovilidad es un síntoma inquietante que se vuelve angustioso apenas se advierte que no es sino el resultado del equilibrio nuclear. La paz no refleja el acuerdo entre las potencias sino su mutuo temor. Los países del Oeste y del Este parecen estar condenados a la inmovilidad o al aniquilamiento. El terror nos ha preservado hasta ahora del gran desastre. Pero hemos escapado de Armageddon, no de la guerra: desde 1945 no ha pasado un solo día sin combates en Asia o en Africa, en América Latina o en el Cercano y el Medio Oriente.
La guerra se ha vuelto trashumante. Aunque no es mi propósito referirme a ninguno de estos conflictos, debo hacer una excepción y ocuparme del caso de la América Central. Me toca muy de cerca y me duele; además, es urgente disipar las simplificaciones maniqueas de tirios y troyanos. La primera es la tendencia a ver el problema únicamente como un episodio de la rivalidad entre las dos superpotencias; la segunda es reducirlo a una contienda local sin ramificaciones internacionales. Es claro que los Estados Unidos ayudan a grupos armados enemigos del regimen de Managua; es claro que la Unión Soviética y Cuba envían armas y consejeros militares a los sandinistas; es claro también que las raíces del conflicto se hunden en el pasado de América Central.
La independencia de la América Hispana (el caso de Brasil es distinto) desencadenó la fragmentación del antiguo Imperio español. Fue un fenómeno de signincación distinta a la independencia norteamericana. Todavía pagamos las consecuencias de esta dispersión: en el interior, democracias caóticas seguidas de dictaduras y, en el exterior, debilidad. Estos males se enconaron en la América Central: varios pequeños países sin clara identidad nacional (¿qué distingue a un salvadoreño de un hondureño o de un nicaraguense?), sin gran viabilidad económica y expuestos a las ambiciones de fuera. Aunque los cinco países - Panamá fue inventado más tarde - escogieron el régimen republicano, ninguno de ellos, salvo la ejemplar Costa Rica, logró establecer una democracia auténtica y duradera. Los pueblos de la América Central padecieron muy pronto el mal endémico de nuestras tierras: el caudillismo rnilitar. La influencia de los Estados Unidos comenzó a mediados del siglo pasado y pronto se convirtió en hegemónica. Los Estados Unidos no inventaron ni la fragmentación ni las oligarquías ni los dictadores bufos y sanguinarios pero se aprovecharon de esta situación, fortificaron a las tiranías y contribuyeron decisivamente a la corrupción de la vida política centroamericana. Su responsabilidad histórica es innegable y sus actuales dificultades en esa región son la consecuencia de su política. A la sombra de Washington nació y creció en Nicaragua una dictadura hereditaria. Después de muchos años, la conjunción de diversas circunstancias - la exasperación general, el nacimiento de una nueva clase media ilustrada, la influencia de una Iglesia Católica renovada, las disensiones internas de la oligarquía y, al final, el retiro de la ayuda norteamericana culminó en una sublevación popular. El levantamiento fue nacional y derrocó a la dictadura. Poco después del triunfo, se repitió el caso de Cuba: la revolución fue confiscada por una élite de dirigentes revolucionarios. Casi todos ellos proceden de la oligarquía nativa y la mayoría ha pasado del catolicismo al marxismo-leninismo o ha hecho una curiosa mescolanza de ambas doctrinas. Desde el principio los dirigentes sandinistas buscaron inspiración en Cuba y han redbido ayuda militar y técnica de la Unión Soviética y sus aliados. Los actos del régimen sandinista muestran su voluntad de instalar en Nicaragua una dictadura burocrático-militar según el modelo de La Habana. Así se ha desnaturalizado el sentido original del movimiento revolucionario.
La oposición no es homogénea. En el interior es muy numerosa pero no tiene medios para expresarse (en Nicaragua sólo existe un diario independiente: La Prensa). Otro segmento importante de la oposición vive aislada en regiones - inhóspitas: la minoría indígena, que no habla español, que ve amenazada su cultura y sus formas de vida y que ha sufrido despojos y atropellos bajo el régimen sandinista. Tampoco es homogénea la oposición armada: unos son conservadores (entre ellos hay antiguos partidarios de Somoza), otros son disidentes demócratas del sandinismo y otros más pertenecen a la minoría indígena. Ninguno de estos grupos busca la restauración de la dictadura. El gobierno de los Estados Unidos les proporciona ayuda militar y técnica aunque, como es sabido, esa ayuda encuentra crecientes críticas en el Senado y en muchos círculos de la opinión pública norteamericana.
Debo mencionar, en fin, la acción diplomática de los cuatro países que forma el grupo llamado Contadora: México, Venezuela, Colombia y Panamá. Es el único que propone una política racional y realmente orientada hacia la paz. Los esfuerzos de los cuatro países se dirigen a crear las condiciones para que cesen las intervenciones extranjeras y los contendientes depongan las armas e inicien negociaciones pacíficas. Es el primer paso y el más difícil. También es imprescindible: la otra solución - la victoria militar de un bando o del otro - sólo seria la semilla, explosiva, de un nuevo y más terrible conflicto. Señalo, por último, que la pacificación de la zona no podrá consumarse efectivamente sino hasta que le sea posible al pueblo de Nicaragua expresar su opinión en elecciones de verdad libres y en las que participen todos los partidos. Esas elecciones permitirían la constitución de un gobierno nacional. Cierto, con ser esenciales, las elecciones no son todo. Aunque en nuestros días la legitimidad de los gobiernos se funda en el sufragio libre, universal y secreto, deben satisfacerse otras condidones para que un régimen merezca ser llamado democrático: vigencia de las libertades y derechos individuales y colectivos, pluralismo y, en fin, respeto a las personas y a las minorías. Esto último es vital en un país como Nicaragua, que ha padecido prolongados períodos de despotismo y en cuyo interior conviven distintas minorías raciales, religiosas, culturales y linguisticas.
Muchos encontrarán irrealizable este programa. No lo es: El Salvador, en plena guerra civil, ha celebrado elecciones. A pesar de los métodos terroristas de los guerrilleros, que pretendieron atemorizar a la gente para que no concurriese a los comicios, la población en su inmensa mayoría voto pacíficamente. Es la segunda vez que El Salvador vota (la primera fueen 1982) y en ambas ocasiones la copiosa votacion ha sido un ejemplo admirable de la vocación democrática de ese pueblo y de su valor civil. Las elecciones de El Salvador han sido una condenación de la doble violencia que aflije a esas naciones: la de las bandas de la ultraderecha y la de los guerrilleros de extrema izquierda. Ya no es posible decir que ese país no está preparado para la democracia. Si la libertad política no es un lujo para los salvadoreños sino una cuestión vital, ¿por qué no ha de serlo para el pueblo de Nicaragua? Los escritores que publican manifiestos en favor del régimen sandinista, ¿se han hecho esta pregunta? ¿Por qué aprueban la implantación en Nicaragua de un sistema que les parecería intolerable en su propio país? ¿Por qué lo que sería odioso aquí resulta admirable allá?
Esta digresión centroamericana - tal vez demasiado -larga: les pido perdón - confirma que la defensa de la paz está asociada a la preservación de la democracia. Aclaro nuevamente que no veo una relación de causa a efecto entre democracia y paz: más de una vez las democracias han sido belicosas. Pero creo que el régimen democrático despliega un espacio abierto favorable a la discusión de los asuntos públicos y, en consecuencia, a los temas de la guerra y la paz. Los grandes movimientos no violentos del pasado inmediato - los ejemplos máximos son Gandhi y Lutero King - nacieron y se desarrollaron en el seno de sociedades democráticas. Las manifestaciones pacifistas en Europa occidental y en los Estados Unidos serían impensables e imposibles en los países totalitarios. De ahí que sea un error lógico y político tanto como una falta moral disociar a la paz de la democracia.
Todas estas reflexiones pueden condensarse así: en su expresión más simple y esencial, la democracia es diálogo y el diálogo abre las puertas de la paz. Sólo si defendemos a la democracia estaremos en posibilidad de preservar a la paz. De este principio se derivan, a mi juicio, otros tres. El primero es buscar sin cesar el diálogo con el adversario. Ese diálogo exige, simultáneamente, firmeza y ductibilidad, flexibilidad y solidez. El segundo es no ceder ni a la tentación del nihilismo ni a la intimidación del terror. La libertad no está antes de la paz pero tampoco está después: son indisolubles. Separarlas es ceder al chantaje totalitario y, al fin, perder una y otra. El tercero es reconocer que la defensa de la democracia en nuestro propio país es inseparable de la solidaridad con aquellos que luchan por ella en los países totalitarios o bajo las tiranías y dictaduras militares de América Latina y otros continentes. Al luchar por la democracia, los disidentes luchan por la paz - luchan por nosotros.
En uno de los borradores de un himno de Hölderlin dedicado precisamente a celebrar la paz y sobre el que Heidegger ha escrito un célebre comentario, dice el poeta que los hombres hemos aprendido a nombrar lo divino y los poderes secretos del universo desde que somos un diálogo y podemos oírnos los unos a los otros.
Hölderlin ve a la historia como diálogo. Sin embargo, una y otra vez ese diálogo ha sido roto por el ruido de la violencia o por el monólogo de los jefes. La violencia exacerba las diferencias e impide que unos y otros hablen y oigan; el monólogo anula al otro; el diálogo mantiene las diferencias pero crea una zona en la que las alteridades coexisten y se entretejen. El diálogo excluye al últimatum y así es una renuncia a los absolutos y a sus despóticas pretensiones de totalidad: somos relativos y es relative lo que decimos y lo que oímos. Pero este relativismo no es una dimisión: para que el diálogo se realice debemos afirmar lo que somos y, simultáneamente, reconocer al otro en su irreductible diferencia. El diálogo nos prohibe negarnos y negar la humanidad de nuestros adversario. Marco Aurelio pasó gran parte de su vida a caballo, guerreando contra los enemigos de Roma. Conoció la lucha, no el odio, y nos dejó estas palabras que deberíamos meditar continuamente: "Desde que rompe el alba, hay que decirse a uno mismo: me encontraré con un indiscreto, con un ingrato, con un pérfido, con un violento ... Conozco su naturaleza: es de mi raza, no por la sangre ni la familia, sino porque los dos participamos de la razón y los dos somos parcelas de la divinidad. Hemos nacido para colaborar como los pies y las manos, los ojos y los párpados, la hilera de dientes de abajo y la de arriba". El diálogo no es sino una de las formas, quizá la más alta, de la simpatía cósmica.
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck und jede andere Art der Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen, die urheberrechtlich nicht gestattet ist, werden verfolgt. Anfragen zur Nutzung der Reden oder von Ausschnitten daraus richten Sie bitte an: m.schult@boev.de
Octavio Paz
Dankesrede des Preisträgers
Chronik des Jahres 1984
+++ Bei dem Besuch von Bundeskanzler Kohl im Januar 1984 in Israel, um die entstandenen Unstimmigkeiten auszuräumen, die sich wegen geplanter Waffenlieferungen der Bundesrepublik an Saudi-Arabien entwickelt hatten, wird die deutsche Nationalhymne erstmals öffentlich in Israel gespielt. Kurz danach hebt der israelische Rundfunk auch den Boykott der Werke von Richard Strauss und Richard Wagner auf. +++ Der über die Parteigrenzen hinweg populäre Richard von Weizsäcker wird im Mai mit großer Mehrheit zum sechsten Bundespräsidenten gewählt. +++
Die im August in Los Angeles stattfindenden Olympischen Sommerspiele werden mit Ausnahme Rumäniens von allen Ostblock-Staaten boykottiert, weil die Sicherheit der Sportler nicht gewährleistet sei. Inoffiziell wird das Ausbleiben als Revanche für den Boykott der Olympischen Spiele in Moskau 1980 gewertet. +++ Frankreichs Staatspräsident Mitterrand und Bundeskanzler Kohl setzen am 22. September auf dem blutigsten Schlachtfeld des Ersten Weltkrieges, in Verdun, ein Zeichen der Freundschaft. Hand in Hand gedenken sie gemeinsam der Gefallenen. +++ Am 31. Oktober wird die indische Ministerpräsidentin Indira Gandhi von zwei Mitgliedern ihrer Leibwache erschossen. Die Täter gehören der Religionsgemeinschaft der Sikhs an, deren Nationalheiligtum, der Goldene Tempel in Amritsar, im Juni von Regierungstruppen erstürmt worden war. +++ In der indischen Stadt Bhopal sterben im Dezember etwa 2000 Menschen an den Folgen einer Giftgaskatastrophe. Das Ausströmen von hochgiftigen Gasen aus einem undichten Ventil einer Pflanzenschutzmittelfabrik führt zu dem Unglück, das auch Tausende von Menschen das Augenlicht kostet. +++
Biographie Octavio Paz
Der am 31. März 1914 in Mexico City geborene Octavio Paz gründet bereits im Alter von 17 Jahren eine eigene Literaturzeitschrift und veröffentlicht wenig später seinen ersten Gedichtband Luna Silvestre (1933). Er studiert Jura und Philosophie in Mexico City, bricht die Ausbildung ab und zieht nach Yukatan, wo er 1937 eine Schule für Arme mitbegründet.
Paz setzt sich fortan für die Arbeiterbewegung ein, distanziert sich allerdings nach dem Hitler-Stalin-Pakt von der Kommunistischen Partei. 1943 tritt Paz in den diplomatischen Dienst ein und wird 1946 nach Paris entsandt. Dort kommt er mit den Surrealisten in Kontakt und schließt mit André Breton Freundschaft.
Von 1946 bis 1968 vertritt er Mexiko als Diplomat in Indien, Frankreich und Japan. 1968 tritt er aus Protest gegen das Massaker an demonstrierenden Studenten auf dem Platz der drei Kulturen in seiner Heimatstadt von seinem Posten zurück. Danach lehrt er an verschiedenen Universitäten.
Der Schriftsteller Octavio Paz hat als Essayist und Dichter mehr als 50 Bände und ein Theaterstück publiziert. In seinen Essays beschäftigt er sich vor allem mit der mexikanischen Identität und ihren Mythen. Liebe und Erotik, Verlorenheit und Einsamkeit, Vergangenheit und Erinnerung sind seine lyrischen Themen. 1990 erhält er den Nobelpreis für Literatur.
Octavio Paz stirbt am 20. April 1998 im Alter von 84 Jahren.
Auszeichnungen
1998 Großkreuz Isabel la Católica
1994 Großkreuz der französischen Ehrenlegion
1990 Nobelpreis für Literatur
1984 Friedenspreis des Deutschen Buchhandels
1982 Neustadt International Prize for Literature
1982 Cervantes-Preis
1980 Premio Ollin Yolitztli
1978 Aigle d'Or
1977 Premio Nacional de Letras
1977 Premio Crítico de Editores de España
1977 Jerusalem-Preis
1963 Grand Prix international de poésie
Bibliographie
Das fünfarmige Delta. Gedichte
Spanisch und deutsch. Aus dem Spanischen von Fritz Vogelgsang und Rudolf Wittkopf, Suhrkamp Verlag, Berlin 2020, Taschenbuch, 217 Seiten, ISBN: 978-3-518-24138-7, 18.00 EUR
Das Labyrinth der Einsamkeit. Essay
Aus dem Spanischen und Einführung von Carl Heupel, Suhrkamp Verlag, Berlin 2017, Bibliothek Suhrkamp 404, Taschenbuch, 220 Seiten, ISBN: 978-3-518-24107-3, 14.00 EUR
Gedichte
Spanisch und deutsch. Übertragung und Nachwort von Fritz Vogelgsang, Suhrkamp Verlag, Berlin 2016, Bibliothek Suhrkamp 551, Taschenbuch, 325 Seiten, ISBN: 978-3-518-24053-3, 13.95 EUR