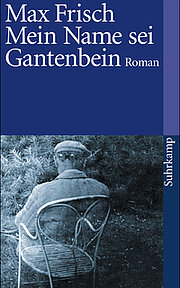1976 wird der Schweizer Schriftsteller und Architekt Max Frisch mit dem Friedenspreis ausgezeichnet. Die Verleihung findet am Sonntag, den 19. September 1976, in der Paulskirche zu Frankfurt am Main statt. Die Laudatio hält Hartmut von Hentig.
Begründung der Jury
Den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verleiht der Börsenverein im Jahre 1976Max Frisch, dem unerschrockenen Mann und geschworenen Feind von Selbstzufriedenheit, Vorurteilen und kollektiven Zwängen. Max Frisch benützt seine große Kunst als Instrument der Mahnung und Warnung, zu Provokation und Protest, für die Rechte des einzelnen, für Freiheit der Gedanken.
Er wird nicht müde, uns den Spiegel vorzuhalten, in dem wir erschrocken und betroffen unsere Unfähigkeit erkennen, den Frieden unter den einzelnen und den Gruppen zu wahren und zu festigen.
Reden
Sie, der Sie Ihr literarisches Handwerk so meisterhaft beherrschen, wenden es an im Kampf gegen Dummheit, Vorurteile und Selbstzufriedenheit. Sie tun das Ihre und auf Ihre Weise, um aufzuzeigen, daß Toleranz, Respekt vor dem Nächsten, ja sogar Nächstenliebe, Voraussetzungen für den Frieden sind.
Rolf Keller - Grußwort
Rolf Keller
Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
Grußwort
Verehrter Herr Frisch, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Um zum anderen Goethe zu bemühen: »- das Publikum sieht sich nach Autoritäten um, und es hat recht.«
Das Oberhaupt unseres Staates, der Bundespräsident, ist heute in Stuttgart bei der Jubelfeier der Naturforscher und Ärzte. So mußte er Sie, Herr Frisch, vorgestern zu sich bitten, um Ihnen seinen Glückwunsch auszusprechen zu der Ehrung, die Ihnen der deutsche Buchhandel zuteil werden lassen will.
Es fehlt in unserer Mitte: Max Tau, der erste Träger des Friedenspreises von 1950, das Ehrenmitglied des Börsenvereins, der beispielhafte Mann der Versöhnung und Vergebung der kaum an einer Feier der Friedenspreisverleihung fehlte. Er ist im März dieses Jahres von uns gegangen.
Nimmt man das lateinische auctoritas = Autorität wörtlich, so heißt es Gültigkeit, Beispiel, Muster, Vorbild: In Ihnen, Herr Frisch, achten wir den Künstler und Ihren Bürgermut. Die Welt ist schwerlich zu verändern und wenn, dann, wie Sie sagen, durch die Arbeit jedes einzelnen an seinem Ort. Das sollte uns hoffnungsvoll werden lassen.
»Es ist schade um die Menschen«, habe ich bei Ihnen gelesen. Vielleicht sind Sie darum das Beispiel, wie Demagogie und Machtmißbrauch, Besserwisserei, Verführungen und missionarischem Übermut der Ideologen entgegengewirkt werden kann. Sie, der Sie Ihr literarisches Handwerk so meisterhaft beherrschen, wenden es an im Kampf gegen Dummheit, Vorurteile und Selbstzufriedenheit. Sie tun das Ihre und auf Ihre Weise, um aufzuzeigen, daß Toleranz, Respekt vor dem Nächsten, ja sogar Nächstenliebe, Voraussetzungen für den Frieden sind.
Ich grüße Sie im Namen des Buchhandels.
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck und jede andere Art der Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen, die urheberrechtlich nicht gestattet ist, werden verfolgt. Anfragen zur Nutzung der Reden oder von Ausschnitten daraus richten Sie bitte an: m.schult@boev.de
Rolf Keller
Grußwort des Vorstehers
Max Frisch hat keine Utopien geschrieben. Er hat vielmehr den schwierigen Weg dorthin beschritten, hat die Hindernisse gezeigt und wie man sie überwindet. Er lehrt die Kleinarbeit, die Praxis: das Lesen der Wegekarte und ihres Maßstabs, das Frühaufbrechen und zur rechten Zeit rasten, bergauf langsam gehen und bergab nicht rasen, und wenn man sich verlaufen hat, nicht anderen die Schuld geben – das nützt nichts.
Hartmut von Hentig - Laudatio auf Max Frisch
Hartmut von Hentig
»Wahrheitsarbeit« und Friede
Laudatio auf Max Frisch
Es gab nach dem Kriege (man muß inzwischen schon sagen, nach welchem - also nach dem sog. Zweiten Weltkrieg) in Deutschland Menschen, die wollten, daß es auch Dichter gebe, die Partei ergreifen - Partei für den Frieden.
Sie haben nicht gesagt, daß alle Dichtung dies tun müsse, und nicht, auf welche Weise. Wie vielfältig das geschehen kann, demonstriert die Reihe der Preisträger seit 1950. Immerhin, es sollte jemand mit den Mitteln der Literatur, der Wissenschaft und der Kunst etwas »zur Verwirklichung des Friedensgedankens beitragen«.
Und da sind wir bei dem entscheidenden Wort: »Verwirklichung« eines Gedankens - nicht einen Gedanken haben oder ihm huldigen, ihn wiederholen, ihn bestätigen, ihn aufschreiben und drucken lassen unter vielen anderen Gedanken. Würde ich das darlegen können: daß Max Frisch zur Verwirklichung einer Hoffnung auf Frieden (und welcher!) beiträgt, oder würde ich nur zeigen können,
- daß sein Werk auch von diesem Thema handelt - von Frieden und Friedlosigkeit, von Friedensnotwendigkeit und Friedensmöglichkeit
- daß es die Gesinnung eines Mannes ausdrückt, die die Stifter des Preises teilen, und
- daß dies auf höchst kunstvolle Weise geschieht?
An dieser Alternative bewährt sich die Preisrede.
Frieden ist eine Sache der Politik; er entsteht nicht beim Lesen eines Buches - auch nicht, wenn sehr viele Menschen dies zugleich tun. Aber eine Voraussetzung dafür, daß eine Politik geschehen kann - durchgeführt, befolgt, angepaßt, verändert, durchgehalten wird -, ist, daß Menschen ihre Ziele, Probleme und Chancen verstehen. Schon die Planung einer Politik ist abhängig von der Frage, wieviel Einsicht und Einwilligung bei den Menschen vorauszusetzen ist: was sie von sich, den anderen, der Lage verstehen.
Zu diesem Verstehen verhelfen
- Menschen mit Erfahrung, die erlebt haben, wie es gegangen ist und darum wahrscheinlich wieder gehen wird: sie vermitteln die Wirklichkeit des Verstandenen (1)
- Menschen, die methodisch untersuchen, was jeweils vorliegt, und es unter allgemeine Erklärungen subsumieren: sie vermitteln die Verläßlichkeit oder Gewißheit des Verstandenen (2)
- Menschen, die Vorstellungen haben, sich ausdenken, wie es sein könnte, die die Wahrnehmung aus ihren Fesseln frei-spielen: sie ermöglichen Vielfalt und Freiheit des Verstehens (3)
- Menschen schließlich, die Mut machen: sie ermöglichen das Wagnis des Verstehens, die Kraft, der verstandenen Wahrheit standzuhalten (4).
In unserem eigentümlichen (modernen) Hang für Zuständigkeiten denken wir bei den ersten (denen mit der Erfahrung) immer in erster Linie an Väter, alte Männer und allenfalls Historiker, bei den zweiten (denen mit der methodischen Gewißheit) an Wissenschaftler und Analytiker, bei den dritten (denen mit der Einbildungskraft) an die Dichter und bei den vierten (den Mitreißern und Mutmachern) an Propheten und Parteiführer. Aber nicht nur nutzt uns die eine Hilfe wenig ohne die anderen - es hat insbesondere ein guter Dichter sicher immer alle vier Möglichkeiten, ja, wo die Sache, deren Verständnis er ermöglichen soll, etwas so Vielseitiges wie der Friede ist, da muß er sie wohl alle vier haben.
Ich habe jedenfalls die Debatten nie verstanden, in denen es vornehmlich darum geht, die Dichter auf eines zu verpflichten: die Entfaltung der Phantasie oder die Formung des richtigen Bewußtseins, die Entdeckung und »Protokollierung« der Realität oder die Kultivierung des Scheins, die Ermächtigung der Gegenrealität.
Der so eingeordnete Dichter ist immer in Gefahr, ungefährlich gemacht zu werden. Daß der Dichter ein Grenzgänger ist, Kompetenzschranken nicht einhält, anderen dreinredet - das macht seine Wirkungsmöglichkeit aus, darum müssen wir ihn fürchten. Hat man nicht gemerkt, wie bedürftig, demütig, hilflos sich die Verwalter der politischen, technischen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen Apparate stellen, wenn es um Visionen geht, die sie vermutlich »konstruktive Modelle« oder »positive Utopien« nennen? Sie reden verdächtig viel von der Notwendigkeit von Alternativen und der sie hervorbringenden »Kreativität« - um so den Dichtern zu schmeicheln und sie auf das Feld der Phantasien zu locken, fort von der politischen Realität. Ich will nicht sagen, daß Phantasien nichts bewirken, und schon gar nicht, daß unsere verwaltete und industrialisierte Welt ihrer nicht bedürfe - nicht borniert, festgelegt, inmitten ständiger Veränderung immobil, Subjekt- und willenlos geworden sei. Aber erstens könnte das Ausdenken einer besseren Welt (beispielsweise einer friedlichen, die zugleich auch frei ist und Freude macht) weniger die Stärke der Dichter sein als die Analyse dessen, was ist (beispielsweise der »Figuren, die unser Hirn — noch immer - bevölkern«; ChM II, 148), vielleicht gehört dazu sehr viel mehr von ihrer Kunst, als wir und sie selber ahnen; zweitens könnte gerade in unserer zuwachsenden Welt das Gegenteil von ihnen gefordert sein, weil es die Politiker nicht können: eine Anleitung zum pfleglichen, liebevollen Umgang mit dem, was wir uns nicht ausgedacht haben, was Menschen nicht machen können, eine Anleitung zur Bescheidung, zur Anerkennung von Grenzen. »Alles, was wir fortan entdecken, es macht die Welt nicht größer, sondern kleiner«, das sagt der verkannte Don Juan in der Chinesischen Mauer, und der, zu dem er das sagt, der ent-täuschte Colombus, antwortet: »Auch Euch, mein junger Mann, verbleiben noch immer die Kontinente der eigenen Seele, das Abenteuer der Wahrhaftigkeit. Nie sah ich andere Räume der Hoffnung.« (ChM II, 184) Beschränkung ohne Resignation - das muß nicht Max Frischs Botschaft sein. Aber was macht das: sie ist bei ihm zu finden!
Noch einmal: Poeten sind doch Phantasten, also das Gegenteil von Bürokraten und Technokraten - und darum, heißt es, brauchen wir sie; die einen sagen: um uns vorzuhalten, wie die Welt sein könnte, damit wir dieser Vision nachgehen; die anderen sagen: um uns zu trösten, daß sie nicht anders ist.
Nach meinem Urteil ist beides zu wenig, beides einseitig - so einseitig, wie wenn die Poeten nur Stimmungs- und Mutmacher sind, so ungenügend, wie wenn sie der Realität in die Poren dringen oder sie ausdeuten, also tun, was Wissenschaftler und Philosophen vor ihnen und für sie getan haben.
Aber was dann?
Ich hätte es schwer, wenn ich Max Frischs Werk nicht kennte, darauf zu antworten. Er ist nicht der einzige Schriftsteller, von dem ich mir vorstellen kann, daß er diesen Preis verdient, aber er ist der, an dem ich verstehe, was vorzüglich Schriftsteller und Dichter dazu leisten können, daß »der Friedensgedanke Wirklichkeit« wird.
Ich formuliere hierzu eine siebenteilige These, um sie dann zu belegen:
- Wie andere Dichter auch, hilft Max Frisch dem Gedanken, der der Friede einstweilen ist, wirklicher zu werden, indem er ihn wahrer und uns, die wir ihn denken, wahrhaftiger macht.
- »Wahrer« heißt: ganz konkret erfahrbar, was uns unfriedlich sein läßt, was Unfrieden und Frieden bedingt, was der Friede uns kosten würde, wie wir uns um ihn betrügen und warum.
- Er ermöglicht damit vielleicht und allmählich, daß wir den schwierigen Frieden doch wollen, auch wenn er zunächst auf unsere Kosten geht.
- Er macht auf die Hindernisse aufmerksam. Wie wir wissen, liegen die Hindernisse auf dem Weg zur Möglichkeit des Friedens in den verschiedensten und machtvollsten Tatsachen: in falschen Wirtschaftssystemen, falschen Herrschafts- und Entscheidungsstrukturen, falschen Vorstellungen und Einstellungen, falschen Verbindungen z. B. von Eigentum und Macht und so fort.
- In dieser Aufstellung kehrt ständig das Wort »falsch« wieder. Es gibt vor, daß wir wüßten, was richtig ist. Die Zerstörung dieser - wieder kommt das tückische Wort - falschen Gewißheit ist die fundamentale Hilfe, die der Dichter Max Frisch gibt.
- Max Frisch - ich widerstehe der Versuchung zu sagen: erzieht uns, nein - hilft uns, es mit einer raffinierten und hartnäckigen Form der Selbsttäuschung aufzunehmen, die uns ständig mit Beschwichtigung oder Gewalt vorlieb nehmen läßt, statt die harte Arbeit, den Verzicht, die Unscheinbarkeit, den mühseligen Ausgleich auf uns zu nehmen, aus dem das Friedenmachen auch besteht.
- Max Frisch hat hierzu - wie kein anderer Dichter - Methoden erfunden: Methoden zum Herstellen von Wahrhaftigkeit. Diese können vielem dienen: der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Freundschaft, dem Glück - und dem Frieden.
Daß Dichter es in einer besonderen Weise mit der Wahrheit zu tun haben, jedenfalls, daß die Wahrheit ohne die Dichtung, nämlich ohne Spiegelung oder Alternative oder Variation oder Gegenbild, nicht die volle Wahrheit ist, weiß man, muß hier nicht an Max Frisch nachgewiesen werden. Wohl aber, wie Wahrheit mit Frieden zusammenhängt.
Wir kennen die anderen Verse dieses langen Liedes:
Freiheit und Friede
Gerechtigkeit und Friede
Friedfertigkeit und Friede
Macht und Friede
Reichtum und Friede
Klassengesellschaft und Friede
die Natur, der Trieb, das sogenannte Böse
und Friede.
Die Wahrheit hat man - nicht nur aus Vergeßlichkeit oder Willkür - ausgelassen. Die Wahrheit erkennen und sagen steht in einem prekären Verhältnis zur Vermeidung von Gewalt, Krieg, Streit, Revolution. Es gibt Übel, die man - wenn man sie einmal erkannt hat - bekämpfen muß. Wer gleichwohl die Ruhe vorzieht - mit dem werden andere streiten oder ihn übergehen, wogegen er dann vermutlich Widerstand leisten wird. Es kommt also, wo die Wahrheit über ein wirkliches Übel erkannt wird, allemal eher zu einer tätlichen Auseinandersetzung; es kommt gerade nicht zu Beruhigung und Frieden.
Mein Standardbeispiel hierfür ist Hitler. Die Großmächte hätten mit dem Zweiten Weltkrieg nicht gewartet, bis Hitler ihn 1939 begann - sie hätten 1933 sofort eingegriffen: wenn sie die volle Wahrheit über den Mann und seine Partei und die Deutschen gewußt hätten.
Man mag sagen, es stand schon alles in >Mein Kampf<, und wer die Wahrheit sehen wollte, konnte sie sehen. Aber das ist gerade das Dilemma: Man kann nicht jede Wahrheit in ihrer schrecklichsten Möglichkeit wissen wollen, weil man dann vermutlich nicht leben könnte. Wer die »volle Wahrheit« über den anderen weiß, ist verführt, ihren möglichen Folgen schnell und gründlich vorzubeugen: Man wird versuchen, ihn daran zu hindern, wenn nötig mit Gewalt. Daß man selber das Gute will, dessen ist man eigentümlich gewiß.
Wie es nicht diese »volle Wahrheit« sein kann, die uns zum Friedenmachen oder Gewaltvermeiden hilft, so auch nicht die bloße Wahrhaftigkeit: das moralische Ehrlichseinwollen gegenüber sich selbst. Die Wahrheit, die auf uns lauert oder die noch nicht weiß, wo sie hin will; das Ich, das sich selbst nicht kennt und das die anderen nicht kennen kann, weil es sie so versteht, wie es sich versteht; das Ich, das sich selbst nicht erkennen will, weil diese Erkenntnis unangenehm ist, Folgen haben sollte; Menschen, die die Bedingungen, unter denen sie erkennen und handeln, nicht kennen, die nicht wissen, welche sie selbst gemacht haben und welchen sie ausgeliefert sind ... das alles fordert mehr als Wahrhaftigkeit, so wie ja auch der Friede mehr fordert als Friedfertigkeit; beide fordern eine bisher unbekannte oder leider verlorengegangene Kunst.
Und dies ist der Schnittpunkt von Friede und Wahrheit: Der Friede - die friedliche und ehrenhafte Lösung eines Konflikts - ist eine so schwierige Sache, daß wir ständig nach Ausflüchten suchen; wir halten nicht stand - der Fülle kleiner Mühsal und kränkender Einsicht in unsere Schwäche. Darum inszenieren wir einen Fall für große Bravour, und die anderen, einschließlich unseres Gegners, fallen willig ein in die schöne Gelegenheit, etwas Kompliziertes zu vereinfachen, eine alte Rechnung zu begleichen, ein abgeschabtes Selbstbewußtsein aufzubessern, eine Unentschlossenheit loszuwerden, einen leidigen Mahner zu übertreffen und ins Unrecht zu setzen ...
Nicht weniger verlockend ist die Beschwichtigung, der beflissene Friede mit dem Unrecht.
Der »vollen Wahrheit«, die man (ich weiß es nicht) vielleicht studiert, erforscht, beweist, der Wahrhaftigkeit, zu der man sich und andere aufruft, setzt Max Frisch etwas entgegen, was ich Methoden genannt habe, eine Technik zur ständigen Herstellung von möglicher Wahrheit, zur ständigen Störung unseres Vertuschens, Verstellens, Verdächtigens, Verfestigens, Verdammens, Verschweigens ... Sagen wir, in Anlehnung an einen Terminus von Sigmund Freud: Max Frisch verordnet uns Wahrheitsarbeit.
Ich will im folgenden erstens (1) diese Mittel oder Methoden aufzählen und kurz beschreiben; ich will dann zweitens (2) die wichtigsten Thesen und Hypothesen nennen, die Max Frisch mit diesen Mitteln verfolgt oder die ihn verfolgen.
(1) Die Mittel oder Methoden der Wahrheitsarbeit
Sein wichtigstes, wirksamstes und poetischstes Mittel ist das Stellen-wir-uns-vor-Spiel, das er in zahlreichen, man möchte meinen: systematischen Variationen spielt - gespielt hat, lange bevor es im »Gantenbein« gleichsam auf seinen eigenen Begriff gekommen ist: in »Nun singen sie wieder«: Stellen wir uns vor, die Menschen, die sich im Leben bekämpfen und umbringen, kämen nach ihrem Tode zusammen und könnten sich miteinander unterhalten - sich die Wahrheit über sich sagen;
in »Die Chinesische Mauer«: Stellen wir uns vor, wir seien in China vor fünfhundert oder tausend Jahren, wir »Heutigen« mit unserem Wissen von der Geschichte und der Wasserstoffbombe, und die »Figuren, die unser Hirn bevölkern«, stünden uns Rede und Antwort; in »Biedermann und die Brandstifter«: Stellen wir uns die Politik einmal wie einen Haushalt vor; oder in »Andorra« unseren Staat als ein Dorf; in »Mein Name sei Gantenbein«: »Ich stelle mir vor«, ich werde für blind gehalten und könnte doch sehen, muß mich aber benehmen, als sähe ich nicht; in »Biografie«: Stellen wir uns vor, wir könnten unser Leben neu leben, indem wir anders entscheiden ...
Und sie alle entlarven uns in einem biedermännischen Bemühen, Gefahren zu verniedlichen, damit wir nicht auf sie reagieren müssen, oder Ungeheuer hervorzubringen, damit wir sie kühn erlegen können.
Mühelos läßt sich eine ähnliche Figur in jedem erzählenden oder dramatischen Werk von Max Frisch nachweisen. Er ist besessen von der Möglichkeit, es lasse sich die Realität durch Variation unserer Vorstellung besser erkennen; oder genauer: er ist besessen von der Furcht, die Wirklichkeit - die durch das tempus perfecti behauptete Wirklichkeit - sei ihrerseits nur eine Vor-Stellung, ein Vor-Wand, ein Aspekt, ein theama oder Schaustück, und erst die Hinzunahme der nichtverwirklichten, der ausgeschlossenen Möglichkeiten mache die Realität daraus; diese, sagt er, erscheine nie auf der Bühne. »Insofern bleibt das Stück immer Probe!« (V 579) Man ist verführt zu denken: nicht nur das Stück »Biografie - von dem hier die Rede ist -, sondern unser Leben überhaupt.
Wie ernst ihm das Spiel ist, mag man den Spielregeln entnehmen. »Was Sie wählen können, ist Ihr eigenes Verhalten« (B V, 490) - also nicht das der anderen und auch nicht die eigenen Eigenschaften. Die Intelligenz beispielsweise ist gegeben. Man kann sie anders einsetzen, schulen oder verkommen lassen - »in einem Glaubensbekenntnis oder in Alkohol« (B V, 503). Aber ihre Reichweite muß man hinnehmen. Was meine Intelligenz sein kann, in anderen Worten, wird durch meine Intelligenz bestimmt und nicht durch meine Wünsche. Das gilt für mein Aussehen, meine Gefühle, meine Spontaneität - für fast alles, außer meinen Willen. Das Spiel definiert wie kein anderes Mittel die Moral. Und so gibt es auch in ihm ständig Einwände gegen das Spiel: »Wie soll man das wiederholen (eine Szene, die zum Anlaufen einer anderen, in der anders entschieden werden soll, gebraucht wird), wenn die Geheimnisse verbraucht sind? - wenn das Ungewisse verbraucht ist, der Sog der Erwartung von Augenblick zu Augenblick...« (B V, 541). Oder: Die erste Ehe von Herrn Kürmann hat mit dem Selbstmord seiner Frau geendet. Daß es die falsche Ehe war, wußte er schon, wußte er mit Intensität, als er zum Altar schritt. Er hat jetzt die Möglichkeit, das zu ändern. »Möchten Sie hier nicht eine andere Wahl treffen?« (B V, 509) fragt der Registrator. Damals hatte Herr Kürmann nicht gegen die Peinlichkeit eines Widerrufs anzugehen vermocht. Und jetzt? Jetzt fällt ihm nicht nur die erhängte Frau ein (das könnte ihm helfen, sich umzuentscheiden), jetzt fällt ihm auch sein Kind ein: »Man kann ein Kind, das einmal da ist, nicht einfach aus der Welt denken.« (B V, 512.) - und so schließt er die Ehe erneut.
Man sieht, es ist ein fürchterliches Spiel. Aber wenn wir es öfter spielten - auch in der Politik -, wir wären weniger dreist in der Behauptung der Wahrheit und in ihrem Vollzug, es gäbe nicht nur Herrn Kürmann ohne die falsche Frau, die »Biografie ohne Antoinette« (B V, 513), sondern vielleicht auch Deutschland ohne diesen, Amerika ohne jenen Krieg.
Wie das in einem Stück geht, kann man sich das denken? Wie sieht das gleiche in einem Roman aus?
»Ich stelle mir vor: ein Mann hat einen Unfall. Er liegt im Hospital mit verbundenen Augen ... Er kann hören, riechen, denken. Und er denkt: Eines Morgens wird der Verband gelöst, und er sieht, daß er sieht, aber er schweigt; er sagt nicht, daß er sieht, niemand und nie.
Ich stelle mir vor: Sein Leben fortan, indem er den Blinden spielt auch unter vier Augen, sein Umgang mit Menschen, die nicht wissen, daß er sie sieht - seine gesellschaftlichen Möglichkeiten, seine beruflichen Möglichkeiten dadurch, daß er nie sagt, was er sieht, ein Leben als Spiel, seine Freiheit kraft eines Geheimnisses usw. - Sein Name sei Gantenbein...« (G V, 21) Er ist ein umgekehrter Gyges, den schon Platon benutzte, um die Reichweite der Moral zu erproben: Was täten Menschen alles, wenn man sie nicht sähe!
»Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält... oder eine ganze Reihe von Geschichten ...« (G V, 49).
Das kann uns festlegen wie den Mann, der sich für einen Pechvogel hält und, als er das große Los gewinnt, lieber die Brieftasche verliert: Der Verlust seines Ichs wäre zu kostspielig (G V, 51).
Das kann uns schrecklichen Möglichkeiten ausliefern: sich vorstellen, man hätte den Mann, dem man auf dem Piz Kesch in aller Einsamkeit begegnet ist, über die Wächte in den Abgrund gestürzt. »Ich wußte, ich habe es nicht getan. Aber warum eigentlich nicht?« (G V, 56)
»Warum eigentlich nicht?« - diese Frage ist der Schatten, den wir nicht mehr los werden, wenn wir einmal begonnen haben, uns vorzustellen . . . Und da wir diese Frage nicht loswerden und sie also auch vor unseren Handlungen da ist, besorgt sie eine wahrhaft unheimliche Freiheit. Wir müssen ernst machen mit dem Ich oder der Vernunft oder der Moral, sonst verlieren wir uns. Frisch hat uns mit diesem Spiel tief in die »Wahrheitsarbeit« gestürzt.
Ein anderes Mittel ist das Tagebuch. Max Frischs Tagebücher sind nicht Chroniken, nicht veröffentlichte Zettelkästen, nicht Confessions-Beichte, Selbstbestätigung und Selbstgericht. Ich meine fast, sie sind seine wenigst privaten Bücher, und jedenfalls sind sie in hohem Maße Produkte von Kunst, von bewußter Verarbeitung der Erlebnis- und Gedankenstoffe. Das Methodische an den Tagebüchern - im beschränkten Sinn meiner These - ist die Unerbittlichkeit, mit der die einzelnen Wahrnehmungen und Reflexionen miteinander konfrontiert und verbunden werden. In den Tagebüchern rekonstruiert er die Fallen, die der private wie der politische wie der poetische Alltag stellt; er will keiner aus barem Zufall entgangen sein. Die Fallen sind meistens nichts als Fälle: wenn man sie in eine bestimmte Konstellation bringt, ist man gefangen. Und wer bringt sie in diese Konstellation? Vermutlich Max Frisch, aber indem sie so aussehen, als seien sie von allein zueinander geraten, überkommt uns der Verdacht, die Wirklichkeit sei so; die Wahrheit lauere in den Ereignissen, wenn wir nur genau hinsähen. Und am Ende sind wir es selber, die die Fallen-Konstellation herstellen.
Hier eine typische Abfolge von Tagebuchbrocken:
- Ein Text für einen Brunnen:
hier ruht kein kalter krieger. dieser stein, der
stumm ist, wurde errichtet zur zeit des
krieges in VIETNAM 1967;
- eine Aufzeichnung über eine Reise nach Prag: Gespräch mit einem namhaften, aber in Ungnade gefallenen Mann in einem Hotel, in dem Mikrophone angebracht sind, ein Gespräch in dem »kein subversives Wort fällt, der Staat ist einfach nicht da ... Es geht um Poesie. Poesie als Resistance?« (T II, 71), und ein Gespräch mit dem in Ehren stehenden Ilja Ehrenburg, ein Gespräch, in dem alles folgenlos gesagt werden kann und sich der Verdacht einschleicht, dies sei nichts als »taktische Schein-Offenheit... Vorsicht, die hier... jedermann gelernt hat wie Orthographie« (T II, 73 f.);
- ein »Verhör«: A fragt B: »Wie stehst du zur Gewalt als Mittel im politischen Kampf?« - anhand eines Textes von Tolstoi - und B antwortet in immer neuen Wendungen und Windungen, er sei Demokrat, für den Rechtsstaat und habe Angst vor der Gewalt: »daher liebe ich die These, die Vernunft könne verändern.« (T II, 84) Er meidet am Ende den Satz, der Staat gebrauche nur Gegengewalt;
- ein Stück Tagesrealität Ende April: Militärputsch zur Verhinderung demokratischer Wahlen in Griechenland. Spiegelung der Ereignisse in der Presse. »Fotos: Griechisches Volk ohnmächtig vor NATO-Tanks unter griechischer Flagge.« (T II, 86)
- Reflexionen zu einem Stück: gegen eine »Dramaturgie der Fügung,... der Peripetie. Im Grunde erwartet man immer, es komme einmal eine klassische Situation, wo eine Entscheidung schlichterdings in Schicksal mündet. Tatsächlich sehen wir, wo immer sich Leben abspielt, etwas viel Aufregenderes: es summiert sich aus Handlungen, die zufällig bleiben ... Jeder Versuch, den Ablauf (einer Geschichte) als den einzigmöglichen darzustellen und sie von daher glaubhaft zu machen, ist belletristisch.« (T II, 87 f.)
- und immer wieder »Reminiszenzen« an die schlimme, die Maßstab setzende Zeit, etwa: wie ihm auf einer Schweizer Behörde (!) 1936 (!) unverlangt ein Ariernachweis erteilt worden ist (T II, 173). Max Frisch erlaubt sich nicht, das mag aus diesem Beispiel einer Abfolge hervorgehen, einfach eine Gebärde der politischen Ästhetik zu tun (Brunneninschrift), er geht selber ins andere Lager, versucht, »kein kalter Krieger« zu sein, und registriert, wenn er diesen Vorsatz verletzt oder im Gespräch nur noch nickt, weil die ändern leider kalte Krieger geblieben sind; er mißt die Erfahrung an allgemeinen Überzeugungen, badet diese im Drachenblut der politischen Theorie, stößt mit dem Speer der Tagespolitik (Statistik, Nachricht, Zeitungsverschnitt) auf die nicht gehürnte Stelle und zieht Folgerungen - selbst für die Formen seiner Kunst.
Ein weiteres Mittel der Wahrheitsarbeit ist eben schon genannt worden:
Das Verhör. Es ist so angelegt, daß einer die wohnliche Gedankeneinrichtung des anderen in Unordnung bringt. A fragt sich auf den Boden der Rationalisierungen von B durch. Er tut es anhand eines Textes, der radikal ist und dadurch zu ungeschützten Bekenntnissen verführt. B hat sich Stellen angestrichen, als er sich mit dem Text allein wähnte. Nun fragt A warum? und fragt nicht von rechts oder von links, sondern von überall! B ist - wie gesagt - für den Rechtsstaat. A setzt nach: »Was versteht du darunter?«; A kommt auf liegengebliebene Probleme zurück; A erlaubt kein Ausweichen. In diesem Verhör, in dem wir B sind, haben wir keinen Gegner - außer unserer Inkonsequenz. Wir geraten in die Zwickmühle, die wir uns selber bereiten - durch allzugroße Sicherheit, allzugroßes Geschick, allzuviel Freude am Rechthaben.
In einem anderen Verhör mit einem B, der wieder den Rechtsstaat verteidigt, zugleich aber froh ist, daß dieser vor der Erpressung durch die Luftpiraten kapituliert hat, um Menschenleben zu retten, fragt A mit abschließender Entschiedenheit: »Bejahst du die Gewalt: Ja oder Nein?«
B: »Es gibt eine Recht-erhaltende Gewalt, ohne die auch der Rechtsstaat nicht auskommt, und es gibt eine Recht-schaffende Gewalt; die letztere antwortet auf die erstere, aber die erstere ist immer hervorgegangen aus der letzteren.«
A: »Bejahst du die Pistole im Cockpit?«
B: »Es steht mir nicht zu, die Pistole im Cockpit zu verurteilen, weil ich ohne sie auskomme. Was ich zum Leben brauche, habe ich ohne Gewalt, das heißt, ich habe es durch die Recht-erhaltende Gewalt. Andere sind in einer anderen Lage; meine Recht-Gläubigkeit ernährt sie nicht, kleidet sie nicht, behaust sie nicht, versetzt sie nicht in den Luxus, auszukommen ohne Gewalt.« ...
A: »Du hast gestanden, daß Akte der Gewalt dich entsetzen. Du bist aber noch immer nicht bereit, die Anwendung von Gewalt grundsätzlich zu verurteilen -«
B: »Es steht mir nicht zu.«
Wir hören in unseren Tagen viel von Dialektik -hier ist sie. Dialektik heißt organisierter, planmäßiger Widerspruch. Meist bekommen wir Dogmatik im Zick-Zack dafür. Mit der Dogmatik kann man besser einschlafen. Aber politischen Frieden wird man nur haben, wenn man gelernt hat, es im Widerspruch auszuhalten. Darum stehen wir im Verhör, bringt Max Frisch es dahin, daß wir uns mit B identifizieren, auch wo wir nicht seiner Meinung sind. Was B sagt, sagt er überlegt und überlegen - und sogar ehrlich. Auch Spitzfindigkeit kann ehrlich sein, wenn das Problem so vertrackt ist. Aber wehe, es fehlt uns dann ein so unbestechlicher und harter Frager wie A!
Stellen Sie sich vor, ich hätte mein vorbereitetes Manuskript beiseite gelegt, als ich hier auf das Podium stieg, und Max Frisch heraufgebeten, um mich so ins Verhör zu nehmen. Thema etwa: Welche und wieviel Ungerechtigkeit bist du bereit, für den Frieden, die Vermeidung von Gewalt auf dich zu nehmen?
Das wäre eine Demonstration der Unerbittlichkeit wie der Nachsicht, also der Aufrichtigkeit und der Klugheit geworden, die das Friedenmachen von uns fordert - eine Demonstration der Notwendigkeit und Preiswürdigkeit von Max Frischs Verfahren.
So aber huldige ich ihm mit dem, was er als unsere - nicht »Heuchelei« (das würden primitivere Kritiker sagen), sondern unsere - Verstrickung in unsere Vorstellungen nennen würde: in die Vorstellungen davon, wie die Dinge zu sein haben (z. B. solche Feiern). Es könnte auch die Angst sein vor der rätselhaften (das ist Max Frischs Wort), der schmuddeligen (das ist mein Wort) Wirklichkeit.
Um die Dialektik vollzumachen, folgen einem solchen Verhör in jenem Tagebuch-Jahr 1967 auch noch die Ermordung von Martin Luther King oder der Aufstand der Studenten in Paris oder die Todesopfer an der Kent State University Ohio - junge Leute, die demonstrierten, weil Amerika in ein neutrales Land eingefallen war. Ich weiß nicht, wie die Leute darauf kommen, daß Max Frisch auch nur »scheinbar immer von sich« spreche.
Ein ähnliches und zugleich ganz anderes Mittel ist der Fragebogen. Auch er kehrt etwa alle 40 Seiten wieder. Die Pointe der Frisch'schen Fragebögen ist, daß man sie ausschließlich für sich selbst beantwortet. Niemand außer mir will das wissen, niemand wird es auswerten. Umso deutlicher merke ich, wenn ich mich selbst betrüge. Das tue ich schon, wenn ich nicht antworte.
Frage 1: »Sind Sie sicher, daß Sie die Erhaltung des Menschengeschlechts, wenn Sie und alle ihre Bekannten nicht mehr sind, wirklich noch interessiert?« Diese Frage ist trefflich erfunden, eines Friedenspreises würdig. Und sie steht mit vollem Recht am Anfang.
Frage 2. setzt arglistig eine positive Antwort zur Frage 1 voraus: »Warum?« (nämlich sind Sie sicher, daß die Erhaltung des Menschengeschlechts Sie dann noch interessiere). Man ist also aufgefordert, auch dann zu antworten, wenn man zunächst zynisch bekannt hat: »Nach mir die Sintflut!« So einfach ist das nicht: Die Sintflut nimmt ja nicht nur die Zukunft weg, sondern den Sinn aller Vergangenheit und Gegenwart. Kann ich das wollen - auch wenn ich ein Zyniker bin? Zur Beantwortung »genügen Stichworte«. Max Frisch macht es einem schwer: In langen Argumentationsketten würde einem vielleicht eine glaubhaft klingende Rechtfertigung gelingen, in Stichworten dagegen gibt man sich leicht preis.
Frage 3 macht den Sprung von der Weltgeschichte zu unserer persönlichsten Entscheidung: »Wie viele Kinder von Ihnen sind nicht zur Welt gekommen durch Ihren Willen?« Frieden und Menschengeschlecht, das sagt sich so leicht, weil wenig Anlaß vorliegt zu der Vermutung, so große Dinge hingen von mir ab. Aber sie tun es!
Frage 6: »Möchten Sie das absolute Gedächtnis?« - Es wäre so unmenschlich wie das absolute Vergessen (das sich Dickens schon in einer Erzählung ausgemalt hat). Die Antwort selbst - man sieht es sofort - ist uninteressant, aber daß man sich fragt und vorstellt, was die möglichen Folgen wären, ist wichtig.
Frage 16: »Überzeugt Sie Ihre Selbstkritik?« Frage 17: »Was meinen Sie, nimmt man Ihnen übel und was nehmen Sie sich selbst übel, und wenn es nicht dieselbe Sache ist: wofür bitten Sie eher um Verzeihung?« Das sind die typischen Fragen in Max Frischs Erkundungssystem: Wie nahe stehen wir uns selbst? Wobei und wann laufen wir zu unserer Schwäche über? Was für ein Bildnis machen wir uns von uns selbst? Frage zo: »Lieben Sie jemand?«
Frage 21: »Und woraus schließen Sie das?« Wenn uns das Selbstverständliche nicht fragwürdig wird, haben wir keine Chance, Fehler oder gar Verbrechen zu vermeiden.
Frage 22:»Gesetzt den Fall, Sie haben nie einen Menschen umgebracht: wie erklären Sie sich, daß es nie dazu gekommen ist?«
Ich kenne Menschen, denen diese Fragen von Max Frisch so unangenehm sind, daß sie das Tagebuch »schlecht« finden, in denen sie stehen. Ich glaube, genauso sind die Fragen gemeint: sie sollen uns aufbringen gegen den, der fragt; aber nachdem man die Frage gelesen hat, ist es nicht mehr Max Frisch, der sie stellt, sondern man selbst.
Neben den Fragebögen gibt es Protokolle, etwa über die Besetzung des Warenhauses Globus in Zürich, und in diesen oder neben diesen die Zusammenstellung von Pressestimmen (T II, 170 ff.), die in ihrer Summe so selbstmörderisch sind wie die Zitate beispielsweise aus einer offiziellen Broschüre zur Zivilverteidigung (T II, 274). Gewiß, das sind Mittel zur Entlarvung anderer. Es ist ja auch wenig wahrscheinlich, daß die Wahrheit nur der eigenen Unwahrheit abzuringen sei.
Wo Max Frisch sich selbst preisgibt, weiß man beklommen: Mea res agitur. Z. B. auf jenen eineinhalb Seiten im zweiten Tagebuch, die »Ehrenwort« überschrieben sind. Einem rabiaten Nationalisten, der ihn auf der Straße mit der Frage anfällt: »Wo möchten Sie wohnen?«, um ihn nach Havanna oder Peking zu wünschen, antwortet er, er sei hier geboren. Die Umstehenden »finden die Frage berechtigt, und ich weiß natürlich, welche Antwort ich der Menge schulde. So viele sind es gar nicht, aber sie haben die Physiognomie der Mehrheit.« Was er von da an sagt, wird von Satz zu Satz unglaubwürdiger. Jede Bekräftigung (»Ich möchte nicht woanders leben, Ehrenwort!«) schwächt die Wahrheit, die dies ist: sie wird ja nicht gesagt, weil sie wahr ist, sondern um den Frieden mit der Menge zu erkaufen. Wer ist sicher, daß er diesen Verrat nie begeht? Wie lebt man mit diesem Zweifel? Wie anders wird man damit fertig, als daß man sich sein Versagen vorhält, daß man weder an der Peinlichkeit erstickt noch anfängt, sich in seiner Schonungslosigkeit zu sonnen? Max Frisch ist das hier gelungen - durch das, was ihn zum Dichter erhebt: er macht die Wahrheit aushaltbar.
Das konventionellste und zugleich anfälligste Mittel ist das der Preisgabe von Entwürfen und Versuchen - wenn also der Autor das Entstehen, Abbrechen, Wiederaufnehmen einer Idee oder einer Gestalt vorlegt: die Wahrheit nicht im Ergebnis, sondern als Bemühung und Probe. Da gibt es im ersten Tagebuch ein in seiner Unfertigkeit überwältigend vollendetes Werkstück - einen Brief an einen jungen Deutschen, der ihm anklagend geschrieben hat; es sind drei Anläufe, jeder anders, jeder anders gestimmt, jeder auf den anderen angewiesen, und am Ende wird keiner abgeschickt.
Natürlich ist das Tagebuch auch einfach Tagebuch: Bericht davon, wie Max Frisch den Tag, die Ereignisse, die Welt erlebt. Er gehört zu dem, was man Prominenz nennt, und geht mit den Großen der Zeit um. Aber er läßt sich dadurch nicht korrumpieren. Er biedert sich nicht an. Er enthält sich der geläufigen, wichtigtuerischen, professionellen Entlarvungen. Er beobachtet - und wenn einer das kann, vermag er ohne Urteil tödlich zu wirken. Auf Max Frischs Höhe erfährt man, daß die Leutseligkeit, die Gelassenheit der Macht so erschreckend ist wie ihre Arroganz, am schlimmsten aber wohl ihre hilflose Verfallenheit an ihre eigene Mächtigkeit. Das sei eine wichtige Frage, sagt Henry Kissinger, die er oft zu hören bekomme (nämlich, wie sich seine wissenschaftliche Theorie bewährt habe oder verändert durch Praxis), aber: »Er habe keine Zeit, darüber nachzudenken.« (T II, 306) Max Frisch dazu: »Wer Entscheidungen fällt oder zu Entscheidungen rät, die Millionen von Menschen betreffen, kann sich nachträgliche Zweifel, ob die Entscheidung richtig ist, nicht leisten ...« (T II, 305) Ich hüte mich, dies hier weiter zu schildern und flink in mein Schema von der Wahrheitsarbeit einzuordnen.
Beim Lesen von Max Frischs politischem digest wird eines gründlich überführt - unsere irrige Meinung, nur was in die Zeitung und auf die Straße, was an hohe Stellen und auf den Bildschirm der Nation gelange: was Massenbasis habe, gehe in die Politik ein und verändere die Wirklichkeit.
Ich komme zu
(2) Thesen und Hypothesen, die Max Frisch verfolgt und die ihn verfolgen
Ich könnte auch einfach von »Wahrheiten« sprechen, die Max Frisch anleiten oder die er gefunden hat. Es sind moralische Wahrheiten.
Es ist für Max Frischs Umgang mit ihnen kennzeichnend, daß er sie sucht, sobald er sie hat. Man hat ihm darum auch vorgeworfen, er habe nur wenige Themen, er wiederhole sie dauernd. Richtig. Aber er langweilt nie. Er sitzt nicht einfach auf seinem Grundstück, er gräbt es um und bringt es zu immer neuem, anderen Blühen. Er verhält sich, mit Verlaub, »empirisch zur Norm«.
Ich beschränke mich auf diejenigen Thesen, die in einem vielleicht nicht offensichtlichen, aber für den Gutwilligen leicht herstellbaren Zusammenhang mit dem Thema Frieden stehen. Die folgenden Aussagen bestehen teils aus Zitaten, teils aus meinen Paraphrasen seiner Maximen:
- Wir neigen dazu, uns ein Bildnis vom anderen zu machen. Wenn wir es tun, ist es ein Zeichen der Schwäche, ja des Verrats: wir halten nicht aus, daß er unbestimmbar ein Rätsel ist.
- Indem wir uns ein Bildnis von ihm machen, sind wir lieblos. Nur die Liebe erträgt es, daß ihr Gegenstand nicht festlegbar, ohne Bestimmung ist und sie selbst darum vielleicht sinnlos.
- Mit dem Bildnis legen wir den anderen nicht nur für uns fest, sondern auch für sich. Er wird zu dem, was das Bildnis vorschreibt: selffulfilling prophecy.
- Das Bildnis trägt die Züge unserer Angst oder unserer Wünsche. »Ganze Völker, die Angst haben vor ihren schlechten Eigenschaften, wollen sich damit helfen, daß sie diese beispielsweise in den Juden projizieren: damit sie ihrem Angst-Ich einmal leibhaftig begegnen, damit sie es quälen und töten können auf eine Manier, die ihnen selber nicht weh tut, aber dafür auch nicht hilft.« (II, 217 f.): der Sündenbock.
- Eine besondere Form von »Sich-ein-Bildnis-machen« ist die Erwartung, ja Behauptung, etwas Geschehenes müsse einen Sinn haben, weil es geschehen ist. »Jeder Verlauf, der dadurch, daß er stattfindet, andere Verläufe ausschließt, unterstellt sich selbst einen Sinn, der ihm nicht zukommt.« (V, 581) Wir ertragen auch hier nicht, daß etwas offen, zufällig, ungereimt bleibt. Und statt Rache zu nehmen für das, was nicht zum Zuge gekommen ist, legen wir es auf das Geschehene fest: Ideologisierung.
- Die Menschen neigen dazu, sich »nicht zur Gegenwart (zu) verhalten, sondern zur Erinnerung«. (B V, 492) So sagt die Mutter am Grab des gefallenen Hauptmanns zu ihrem kleinen Sohn: »Alles das Stolze, alles das Ehrenvolle, was dein Vater erstrebt hat - du, sein Sohn, wirst es weiterführen.« Während die Toten protestieren: »Es ist ein Irrtum gewesen« und »Er soll Schafe scheren, er soll mein Erbe nicht sein« und »Sie nehmen die Worte aus unserem Leben, sie machen ein Vermächtnis daraus, wie sie es nennen, und lassen uns nicht reifer werden, als sie selber sind.« (NSSW II, 134 f.)
- Wo es nicht gelingt, der schlimmen Vergangenheit einen Sinn zu unterstellen, verdrängen wir sie. »Von ihnen (den Verbrechen des Krieges) nichts mehr wissen zu wollen, wird unsere eigene Schmach (mit diesem Wort zitiert Frisch Karl Kraus): indem wir zwar ertragen, daß es diese Dinge weiterhin gibt, aber nicht, daß es sie gab.« (II, 279) Wahrheitsarbeit ist mit Trauerarbeit verwandt.
- Neben dem Bedürfnis nach einem Sündenbock ist das Ressentiment, der Neid auf den Stärkeren oder Freieren, auf den, der anders ist und doch glücklich, das schlimmste Gift in unseren Beziehungen; Haß als Gesinnung, Feindschaft als Gefühl sind seltener, schwieriger, von kürzerer Dauer als das Ressentiment.
- Die politischen Konstrukte - Nationalstaaten, Militärbündnisse, Gesellschaftssysteme - brauchen solidarische Mitglieder; das einfachste Mittel zur Herstellung von Solidarität und zur Abstellung von Kritik - ein Mittel das auch dann funktioniert, wenn das Gebilde schwach, korrupt, im Unrecht ist - ist das Feindbild.
- Dem »Feind« im Feindbild bekommt Ressentiment besser als Haß; Haß ist auf Nähe, Erfahrung, Kontakt angewiesen wie Liebe; Ressentiment lebt von der Ferne seines Objekts.
- Ressentiment nährt sich aus Minderwertigkeitsgefühlen - der »andorranischen Angst, Provinz zu sein, wenn man einen Andorraner ernst nähme«. (T I, 12) Und selbst »ein Andorraner, der Geist hat und daher weiß, wie sehr klein sein Land ist, hat... eine lebenslängliche Angst, daß er die Maßstäbe verliere«. (T I, 12) (Für gewalttätiges Verhalten braucht man eine Reizung
- oder Angst und möglichst wenig Einsicht in die Folgen; zur Beschwichtigung nur Angst; zu friedlichem Handeln dagegen klare, also ehrliche Erkenntnis; ihr stehen im Wege:)
- mangelndes Selbstvertrauen: »Ein Ausländer unter sieben Einheimischen, und wer ist besorgt, daß die andere Lebensart ihn anstecken könnte: die sieben Einheimischen« (V, 383);
- Arroganz - der Macht wie der Ohnmacht -, die nicht zuhört, »die keine Anwort mehr zuläßt«, die selbst noch die Niederlage, die Schuld, das Leid als Auszeichnung erlebt (T I, 145), verwandt mit dem
- Selbstmitleid, das wieder eine Art von höherem Sinn oder tieferer Bedeutung für sich beansprucht. »Daß es auch Elend gibt ohne sittlichen Ertrag, Elend, das sich auch in Geist und Seele nicht lohnt, darin besteht wohl das eigentliche Elend, das hoffnungslos ist, tierisch und nichts als dies, und jede Verbeugung davor schiene mir schamlos, eine Weihung der Bomben, eine literarische Ehrfurcht, die immer noch auf die Vergötzung des Krieges hinausläuft, also auf das Gegenteil unserer Aufgabe, daß wir das Elend bekämpfen...« (TI, 145 f);
- die Neutralität aus naiver Überzeugung: weil nicht zu streiten besser sei als zu streiten, habe der Nichtstreitende auch das bessere Urteil.
- (Freilich, mit der sophisticated, bewußten Neutralität ist man nicht besser dran: man weiß, daß man nicht urteilen kann, weil man »es« nicht am eigenen Leibe erfahren hat, und muß doch urteilen, weil man sonst seinem eigenen Leben ohne Maßstab ausgeliefert wäre. Diese Gespaltenheit macht den wahren Neutralen für die anderen so unverständlich, isoliert ihn, zerstört seine Chance: »Der Kämpfende kann die Szene nur sehen, solange er selbst dabei ist; der Zuschauer sieht sie immerfort ... [und ohne] Versuchung zur Rache. Vielleicht liegt darin das eigentliche Geschenk, das den Verschonten zugefallen ist, und ihre eigentliche Aufgabe: sie hätten die selten gewordene Freiheit, gerecht zu bleiben.«) (T I,150)
Mit dieser Sammlung habe ich mir bei meiner Aufgabe geholfen, das Verhältnis von Wahrheit und Friede zu verdeutlichen. Aber ich habe Max Frisch einen schlechten Dienst getan. Er hat ja nicht Aphorismen zur Lebensweisheit geschrieben, sondern in einer heiklen oder aufschlußreichen Lage etwas auf diese hin oder von dieser her gedacht. Es sind oft sogar Gedanken, die nicht er, sondern eine seiner Figuren in ihrer fingierten Lage denken muß. Und nun habe ich verallgemeinert, und wer Frischs »Philosophy of life« in Kurzform haben will, liest in Zukunft hier nach.
Aber es gibt eben auch bei Frisch Grunderfahrungen und Grundüberzeugungen. Und wer sich anmaßt, von Frischs Methode der Wahrheitsarbeit zu reden, ohne deren Gegenstand zu nennen, der hätte Frisch noch mehr verfälscht.
Ich denke, mit einem gehörigen caveant audientes oder caveat lector ist mein Vorgehen nicht nur zulässig, sondern auch nützlich: Die Frisch'schen Wahrheiten enthalten ihr eigenes Antitoxin: sie verallgemeinern zwar, aber nur in dem Maß, das nötig ist, um der begrifflichen Verallgemeinerung zu begegnen, die wir aus Lebensschwäche begehen. Dieser Schwäche kommt eine große und gefährliche Philosophie zur Hilfe: der Idealismus. Idea = eidos = das Bild. Idealismus = Bildniswahrheit = es ist nichts erkennbar ohne einen Begriff. Diese Philosophie gibt die Zeit, das Individuum, das sich in der Zeit individuierende Leben für unwichtig aus.
Max Frisch wehrt diese Philosophie »unphilosophisch« ab - durch die Fülle glaubwürdiger Erscheinungen und Erfahrungen, die sich der Verallgemeinerung widersetzen. Aber von dieser Tatsache hat er sehr wohl einen Begriff, der in seiner kürzesten und allgemeinsten Form heißt: Du sollst dir kein Bildnis machen. - Und dies sagt er nicht, weil er das Erkennen und Leben mit Bildern, Vorbildern, Abbildern für eine schwache, unmenschliche Möglichkeit hält, sondern weil er weiß, wie menschlich und überwältigend stark sie ist.
Von der Person, die den Preis bekommt, habe ich nicht gesprochen. Ich bin nicht sicher, ob ich sie gut genug kenne. Ich weiß, wie Max Frisch wohnt, ich bin mit ihm gewandert, ich habe erlebt, wie er sich in einer neuen Begegnung verhält, er hat mir ein wenig über Ingeborg Bachmann erzählt, ich kenne seine Frau. Aber in alledem ist nichts anders als in seinem Tagebuch: ein Teil Politik, ein Teil Umgang mit Menschen - und dahinter ein Abgrund von Wahrheitsarbeit an der eigenen Person. Wenn der Vorwurf stimmt, er sei in seinem Werk zu persönlich, dann muß ich nicht bang sein, wenn ich mich so ausschließlich ans Werk gehalten habe. Stimmt, was ich meine (und er selber auch), daß seine Sache vornehmlich die Selbsterfahrung und Selbstprüfung ist, die er für andere als eine Art Modell bereitstellt, dann darf ich nicht bange sein.
Es wird Ungeduldige geben, die sagen: dies sei und bleibe Literatur. In der Tat, hier wird kein Polenvertrag geschlossen und keine Steuer zur Unterstützung der Dritten Welt erhoben. Max Frisch kann nur dir und mir zeigen, was wir tun können und damit wir zu mehr bereit sind. Andere haben anderes beizutragen. Weil Frieden eine so umfassende, nicht teilbare Sache ist, verführt er zu Totaltheorien. Das wäre nicht so schlimm, folgte ihnen nicht eine Politik des Alles oder Nichts. Und die - anderes haben wir nicht erlebt - endet mit Nichts.
Was ich versucht habe, war dies: Ich wollte Ihnen zeigen, was es heißen kann: durch Dichtung, die etwas Nicht-Praktisches ist, helfen, einen Gedanken zu verwirklichen. Ich habe den Verdacht geäußert, daß die der Dichtung in solchen Zusammenhängen meist zugewiesene Rolle, Gegenwelten zu entwerfen, die Phantasie anzuregen, Mut zur Utopie zu machen, ein - vielleicht unbewußter - Versuch ist, sie auf die glanzvollere aber wirkungslosere Aufgabe abzudrängen. Dichtung als Diagnostik, als Anleitung zur Selbsterkenntnis, als Mittel zur Auflösung der Mythologie des Alltags, als Sprache, in der ich die Figuren, die mein Hirn bevölkern, zur Rede stelle, als Spiel, mit dem ich meinen inneren Gegenspieler überspielen kann, Dichtung als ein Verfahren (oder auch Prozeß) gegen die gefälligen und hartnäckigen Scheingewißheiten, die uns zu Anbiederung oder Vergewaltigung verführen - diese Dichtung ist seltener und des Ruhmes an dieser Stelle würdiger.
Utopien brauchen wir. Aber wir werden sie verstoßen, verwünschen, verleumden, wenn wir merken, daß wir ihnen nicht näher kommen.
Das ist doch die »Tendenzwende«: nicht eine Ursache für die Preisgabe von Hoffnung, Fortschritt, Reform, sondern selbst eine Folge davon, daß diese so schnell und einfach nicht vor sich gegangen sind, wie geplant.
Max Frisch hat keine Utopien geschrieben. Er hat vielmehr den schwierigen Weg dorthin beschritten, hat die Hindernisse gezeigt und wie man sie überwindet. Er lehrt die Kleinarbeit, die Praxis: das Lesen der Wegekarte und ihres Maßstabs, das Frühaufbrechen und zur rechten Zeit rasten, bergauf langsam gehen und bergab nicht rasen, und wenn man sich verlaufen hat, nicht anderen die Schuld geben - das nützt nichts.
Mag sein, daß er das gar nicht gewollt hat. Und verständlich, wenn er nicht will, daß die Utopie uns einfach vergeht. Ja, wenn er hier steht und die Utopie hochhält, dann will vor allem ich als Pädagoge dankbar dafür sein. Meine Aufgabe an dieser Stelle freilich war es nicht, Max Frisch recht zu geben, sondern ihn zu loben: dafür, daß er uns - nämlich dir und mir - hilft, den Frieden, der einstweilen nur eine Hoffnung ist, zu verwirklichen.
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck und jede andere Art der Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen, die urheberrechtlich nicht gestattet ist, werden verfolgt. Anfragen zur Nutzung der Reden oder von Ausschnitten daraus richten Sie bitte an: m.schult@boev.de
Hartmut von Hentig
Laudatio
Ob der Überlebenswille der Gattung ausreichen wird zum Umbau unsrer Gesellschaften in eine friedensfähige, weiß ich nicht. Wir hoffen. Es ist dringlich. Das Gebet entbindet nicht von der Frage nach unserem politischen Umgang mit dieser Hoffnung, die eine radikale ist. Der Glaube an eine Möglichkeit des Friedens (und also des Überlebens der Menschen) ist ein revolutionärer Glaube.
Max Frisch - Dankesrede
Max Frisch
Wir hoffen
Dankesrede
Der Preis, der hier von Jahr zu Jahr verliehen wird zur Zeit der Messe, ist kein literarischer Preis. Hier ist nicht zu sprechen über Literatur als Notwehr oder Ware. Die diesen Preis verleihen, verstehen Literatur als ein Vehikel für Gesinnung und verbinden die Ehre, die durch die Anwesenheit hoher Behörden unserem Berufsstand erwiesen wird, mit der Herausforderung, etwas über den Frieden zu sagen.
»Ich erschrak,« so Sigmund Freud an Albert Einstein, der 1932 in einem Brief gefragt hatte, was man denn tun könne, um das Verhängnis des Krieges von den Menschen abzuwehren: »Ich erschrak zunächst unter dem Eindruck meiner - fast hätte ich gesagt: unserer - Inkompetenz, denn das erschien mir als eine praktische Aufgabe, die den Staatsmännern zufällt.« Den Nachsatz könnte auch der sogenannte Mann-von-der-Straße gesagt haben. »Ich verstand dann aber«, so schreibt Freud weiter an Einstein, »daß Sie die Frage nicht als Naturforscher und Physiker erhoben haben, sondern als Menschenfreund, der den Anregungen des Völkerbundes gefolgt war«, und vor seiner Analyse, warum es unter Menschen zum Krieg kommt, nochmals die Bescheidenheit des Gelehrten: »Ich besann mich auch, daß mir nicht zugemutet wird, praktische Vorschläge zu machen.« Sieben Jahre später brach der Weltkrieg aus... Unser Wunschdenken nach Hiroshima, die Meinung nämlich, daß die Atombombe nur noch die Wahl lasse zwischen Frieden oder Selbstmord der Menschheit und infolgedessen den Ewigen Frieden herbeigeführt habe, hat nicht lang gehalten: Krieg in Korea, Krieg im Nahen Osten. Begnügen wir uns mit der Hoffnung, daß es ohne Atombombe geht? Der Krieg in Vietnam, geführt und verloren von unsrer Schutzmacht, hat im Einsatz von Vernichtungswaffen den letzten Weltkrieg übertroffen - ohne Atombombe - und zudem wiederholt, was seit Nürnberg als Kriegsverbrechen definiert ist. Die neueste Hoffnung, man weiß, geht dahin, daß ein nuklearer Schlagabtausch (Krieg wird da ein romantisches Wort) zwar keineswegs auszuschließen ist, daß er aber nicht das ganze Menschengeschlecht vernichte, sondern nur die Hälfte etwa, vielleicht sogar nur ein Drittel. Wer heute von Frieden redet und unter Frieden etwas anderes versteht als eine temporäre Waffenruhe bei unentwegter Pflege der Feindbilder wechselseitig, sodaß die Abschreckungs-Strategie die einzig denkbare bleibt, spricht von einer Utopie, und dasselbe gilt für die Freiheit, ohne die (wie es an dieser Stelle schon dargelegt worden ist) kein Friede ist. Zu fragen bleibt also nach unserem politischen Umgang mit der Utopie.
Beginnen wir mit der Freiheit.
Sicher in der Verneinung jeder Art von Diktatur, sowohl einer sogenannten Diktatur des Proletariats als auch einer Diktatur der Besitzenden, die sich freilich nie so nennen wird, bin ich Demokrat, als Demokrat nicht euphorisch. Demokrat ist man in der Hoffnung, daß Herrschaft in rationale Autorität übergeführt werde. Wir brauchen den Staat, nicht seine Vergötzung als Obrigkeit, was ein Relikt feudaler Herrschaft ist. Man weiß es: je mündiger wir wären, umso weniger Staat wäre vonnöten; schon das macht den Staat zum steten Ärgernis: seine Notwendigkeit verweist auf unseren Mangel an Solidarität, unsere Unzuverlässigkeit, unseren Mangel an Vorstellungskraft, wie mein Tun und Lassen sich für die Nachbarn auswirkt oder für die Nachkommen. Eigentum verpflichtet, so sagt das Grundgesetz und fügt hinzu: Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Kann man es höflicher sagen? Noblesse oblige; wenn aber die Eigentümer-Macht, zum Beispiel die Boden-Spekulation, auf solche Noblesse, die ihr die Väter des Grundgesetzes unterstellen, gar keinen Wert legt? Wir brauchen also den Staat. Der Ruf nach Freiheit, mehr Freiheit vom Staat, ist prüfenswert; kommt er von Mitbürgern, die zugleich die Polizei verstärkt haben möchten, so wissen wir, wessen Freiheit da gemeint ist: die Freiheit für die Wenigen, die den Staat, sobald sie ihn in der Hand haben, lieber nicht als Staat bezeichnen, sondern als Vaterland, das Opfer verlangt von der Mehrheit... Der Grund, warum ich als Demokrat nicht euphorisch bin, ist dieser: die parlamentarisch-demokratische Apparatur, eingespielt auf Kompromiß in Permanenz, erzieht nicht nur zur Toleranz, was ja eine humane Qualität wäre über den staatsbürgerlichen Bezirk hinaus, mehr noch erzieht sie zur Resignation, zur Preisgabe jeder Utopie. Unter Demokratie-Praktikern ist Utopie das schlichte Synonym für Hirngespinst. Was eines Tages bleibt: eine Technokratie, als solche effizient; es schwindet die spirituelle Substanz der Politik. Es bleibt: Politik als Fortsetzung des Geschäfts mit ändern Mitteln, ein gewisser Wohlstand für die meisten als Köder zum Verzicht auf Selbstbestimmung, die Verkümmerung unsrer Humanität in Komfort-Hörigkeit... Die Jugend, die in den späten Sechziger Jahren als Außerparlamentarische Opposition auftrat, merkte diese schleichende Resignation und wehrte sich: in Frankreich mit Allüren aus der Erinnerung an die Erstürmung der Bastille, es kam zu Bildern, die an Delacroix erinnern; in der Bundesrepublik theorie-rabiat und mit der Intransigenz von Revolutionären, die sich ohne Massen-Basis sehen. Das ist gewesen. Schüler und Lehrlinge, sogar Studenten, befragt nach ihren Gedanken über die Aufgaben einer Demokratie, zucken heute die Achsel. Sie wissen, was es sie kosten kann, wenn sie Gebrauch machen von dem verfassungsmäßigen Recht auf Meinungsfreiheit. Daß es gelungen ist, sogar die Jugend in die Resignation zu zwingen, ist kein Triumph der Demokratie. Die hektische Suche nach dem Verfassungsfeind, wobei man sich selber für verfassungstreu hält, ohne die großen Versprechen der Verfassung zu erfüllen, die Suche nach dem Sündenbock also, begleitet von dem pharisäerhaften Erbarmen mit den Dissidenten anderswo, kennzeichnet eine Gesellschaft, die Angst davor hat, daß ihr Bekenntnis, das demokratische, beim Wort genommen wird: eine Profit-Konkurrenz-Gesellschaft mit demokratischem Vokabular, wobei es eine Lüge wäre zu sagen, eben die Konkurrenz garantiere ja, daß die Leistung entscheide; es bleibt, wie liberal man sich in der Rede auch gibt, eine Konkurrenz zwischen Bevorzugten und Benachteiligten. Um aus der öffentlichen Diskussion zu verbannen, was die Bevorzugten ungern hören, nämlich Kritik an der veritablen Struktur unsrer Gesellschaft und Zielvorstellungen, demokratische, genügt heute schon da und dort die Etikette: links, wie es einmal genügt hat, vor langer Zeit, zu sagen: entartet. Nun meine ich nicht, daß Geschichte sich haargenau wiederhole. Ich beobachte bloß: ein Klima des Ressentiments. Kein Fememord; nur eben eine Allergie gegenüber politischem Bewußtsein, das zu analysieren vermag. Keine Schutzhaft; nur eben die Verweigerung des Diskurses, hierfür genügt zunächst der Radikalen-Erlaß, die Legitimation eines Ressentiments durch den administrativen Pakt mit diesem Ressentiment.
Meine Damen und Herren,
als Ausländer gehalten (ich weiß!) mich nicht einzumischen in die inneren Angelegenheiten der Bundesrepublik, deren intellektuelle Potenz wir bewundern, deren wirtschaftliche Potenz ihr das Selbstbewußtsein gibt, Modell zu sein - ob auch für Italien und Frankreich, darüber haben die italienischen und französischen Wähler zu befinden - als Ausländer verweise ich, da die Rede sein soll vom Frieden, auf ein Phänomen, das zur Friedensfrage gehört und sich nicht in Landesgrenzen hält. In meiner staatsbürgerlichen Heimat haben wir ungefähr dieselbe Praxis: ohne gesetzliche Erlasse zum Schutz der Demokratie durch Abbau der Demokratie. Als Schriftsteller hat mich beschäftigt die Genesis der Feindbilder: wie ein Ressentiment, Projektion der eignen Widersprüche auf einen Sündenbock, ein Gemeinwesen erfaßt und irreführt; die Epidemie der blinden Unterstellung, der Andersdenkende könne es redlich nicht meinen; wie aus der Angst vor Selbsterkenntnis (sie fällt uns allen schwer) der kollektive Haß entsteht, der ein Feindbild braucht, dieses oder jenes; die Verfemung einer Minorität mit dem paradoxen Ergebnis, daß die Majorität sich dabei selbst entmündigt: - indem schließlich jedermann, der an solcher Verfemung nicht teilnimmt, weil sein Gewissen es ihm verbietet, sich selber der Verfemung aussetzt, wird die Majorität gewissenlos und feige, das heißt aber: regierbar als eine Majorität von Untertanen.
OHNE FREIHEIT KEIN FRIEDE
Die Jahre des Kalten Krieges zeigten in einem Kleinstaat, der militärisch ohnehin verloren wäre, vielleicht besonders deutlich, was auch anderswo gilt: daß das Feindbild, wie es der Kalte Krieg entwickelt hat und wie es heute weiter gepflegt wird, nicht zuletzt einen innerstaatlichen Zweck hat, die Erhaltung eben einer Herrschaft, die ohne Abschreckung nicht auskommt. Die schiere Unmenschlichkeit auf der ändern Seite (und etwas anderes ist im Kalten Krieg ja nicht zu vernehmen) als Dispens von jeder Selbsterforschung; das stupide Muster: Wer Kritik übt am eignen Land, stehe im Sold des Feindes. Nicht daß die Mitbürger, die seit zwei Jahrzehnten dieses Muster gebrauchen, den wirklichen Krieg wollen, den China vermutlich überlebt, aber nicht Europa; der Zweck des Kalten Krieges ist die Tabuisierung der vorhandenen Herrschaftsform ... Das würde bedeuten: der Friede (als ein Zustand nicht ohne Auseinandersetzung, aber ohne die Drohung mit der Katastrophe) ist nicht in erster Linie, wie es täglich dargestellt wird, eine Sache der Strategie, der militärischen und der diplomatischen; er ist auch nicht herzustellen durch persönliche Sanftmut, bis eines Tages der Marschbefehl kommt, der Fahneneid, der Schießbefehl; er ist herzustellen nur - im Sinn der These: Ohne Freiheit kein Friede - durch den Umbau der Gesellschaft in eine Gemeinschaft.
WOZU DIE UTOPIE?
Ob es die Utopie ist von einer brüderlichen Gesellschaft ohne Herrschaft von Menschen über Menschen oder die Utopie einer Ehe ohne Unterwerfungen, die Utopie einer Emanzipation beider Geschlechter; die Utopie einer Menschenliebe, die sich kein Bildnis macht vom ändern, oder die Utopie einer Seligkeit im Kierkegaard'schen Sinn, indem uns das allerschwerste gelänge, nämlich daß wir uns selbst wählen und dadurch in den Zustand der Freiheit kommen; die Utopie einer permanenten Spontaneität und Bereitschaft zu Gestaltung-Umgestaltung (nach Johann Wolfgang Goethe: Des ewigen Sinnes ewige Unterhaltung), alles in allem: die Utopie eines kreativen und also verwirklichten Daseins zwischen Geburt und Tod - eine Utopie ist dadurch nicht entwertet, daß wir vor ihr nicht bestehen. Sie ist es, was uns im Scheitern noch Wert gibt. Sie ist unerläßlich, der Magnet, der uns zwar nicht von diesem Boden hebt, aber unserem Wesen eine Richtung gibt in schätzungsweise 25000 Alltagen. Ohne Utopie wären wir Lebewesen ohne Transzendenz.
WOZU DAS RESSENTIMENT GEGEN DIE LINKE UTOPIE?
Ohne Zweifel hat es mit den studentischen Unruhen zu tun, obschon sie an den Besitzverhältnissen nicht das mindeste geändert haben. L'imagination au pouvoir! General de Gaulle (und das heißt: der Staat) hat den Tumulten standgehalten, nicht zuletzt dank der Kommunistischen Partei. (Ich befand mich damals in Moskau und hörte die Angst eines Funktionärs, die Spontaneität könnte Schule machen.) In den Vereinigten Staaten: Free Speech movement, das erste Erwachen aus dem Amerikanischen Traum während des Pseudo-Kreuzzuges in Vietnam, dazu die Blumenkinder, Revolte mit der Gitarre, naiv, let us be, ohne ohrenbetäubende Theorie; die Staatsmacht, die in Kent State nicht ohne Morde auskam, blieb ungefährdet. Auch in der Bundesrepublik - der Student Benno Ohnesorg, der den Schah von Persien nicht am Genuß der deutschen Oper hinderte, wurde von einem Wachtmeister versehentlich erschossen - war die Staatsmacht nicht eine Viertelstunde lang in Gefahr. Warum bleibt trotzdem ein Schock? Als habe man sich an Massaker zu erinnern, mindestens an einen Total-Streik. Nicht die Arbeiterschaft ging auf die Straße oder besetzte eine Universität; Söhne und Töchter des Bürgertums wollten wissen, worauf die Autorität in unsrer Gesellschaft gegründet ist. Eine statthafte Frage, wenn auch unerwartet in einer Zeit der Konjunktur, die doch Karrieren anbot. Statt stiller Teilnahme am Geschäft, das diesen Bürgerkindern offenstand, das plötzliche Aufkommen politischen Bewußtseins; die Universität, eben noch eine Karriere-Schule, plötzlich als Forum. Dabei hat sich gezeigt: was die Eigentümer-Macht, bisher ihrer Autorität gewiß, anzubieten hat außer einer Fülle von Konsum-Gütern, welche Perspektive für eine humanere Welt, welche sittlichen Werte, die nicht durch ihre Praxis annulliert werden, welche Hoffnung für alle oder auch nur was sie selbst beseelt, abgesehen von dem Glauben an die freie Marktwirtschaft, ist dürftig. Profit als Wonne der Persönlichkeit? Es hat sich gezeigt, meine ich, eine Leere. Inzwischen gibt es, außer der Polemik in der großen Presse, die der Eigentümer-Macht gehört, eine konservative Utopie-Kritik von wissenschaftlicher Statur. Gibt es (ich muß fragen, da ich nicht Fachmann bin) eine Sozial-Ethik, die der Macht durch Eigentum, zum Beispiel einem Nestlé-Konzern oder Hoffmann-La Roche, Autorität einbringt? In Verbindung mit dem Versuch, die Intellektuellen zu diskreditieren, hören wir die laute Sorge um die Rechtsstaatlichkeit, die verletzt worden ist, in der Tat, durch einige Verzweifelte und Verirrte - wobei die Rechtsstaatlichkeit, Voraussetzung einer gesitteten Gesellschaft, zum Wert an sich erhoben wird: als lebten wir, wie auch immer, für den Rechtsstaat schlechthin. Gemeint ist wohl, daß die Besitzverhältnisse unantastbar sein sollen. Es hilft nichts zu sagen: Ihr sollt euer Haus und euren Garten behalten und dies und das, nur nicht die Möglichkeit, daß Macht durch Eigentum eine vom Volk gewählte Regierung aus dem Sattel stoßen kann, indem sie, zum Beispiel, Krisen veranstaltet und dazu Waffen liefert wie im Fall von Chile, wo seither gefoltert wird. Es hilft nichts, denn es geht nicht um Haus und Garten und was jedermann zu gönnen wäre, sondern um ein Axiom: daß ein Dasein ohne Macht über andere ein menschenunwürdiges Dasein sei und eine andere Art von Selbstverwirklichung (wobei man vielleicht ohne Psychiater auskäme) undenkbar. Die in dieser Vorstellung von Menschenwürde erzogen und befangen sind, bekleiden sich mit der Rede von ihrer Verantwortung. Haben sie infolgedessen eine Hoffnung auf Menschenwürde für alle nicht anzubieten - denn solange Menschenwürde darin besteht, daß wir Macht über andere haben, muß es ja auch diese ändern geben -, so bleibt, will man die Mehrheit im Parlament, als gemeinsamer Nenner die Angst: vor der Krise, vor der Arbeitslosigkeit, vor dem Feind, dessen militärische Rüstung in der Tat bedrohlich ist. Nur entwaffnen wir ihn nicht durch Unterbringung von Reformen im eigenen Land. Die Eigentümer-Macht; dabei denke ich an Personen, die zu treffen man Gelegenheit hat als Schriftsteller in Ehren und die, wenn ich manierlich zuhöre, schon beim Aperitif einen lapidaren Konsensus anstreben; Sätze wie diese: Eine einzige Atombombe auf Hanoi hätte den Amerikanern all diese Schwierigkeiten erspart / oder zur Lage in Argentinien: Solche Leute können ja nur zerstören, das sind nicht Menschen wie Sie und ich, Herr Doktor, die haben noch nie ein Buch gelesen, man muß sie ausrotten wie früher einmal die Indianer / oder: Daß da Säuglinge massenhaft sterben, mag sein, sie sterben auch ohne dieses Milchpulver, aber es geht diesen jungen Akademikern ja nicht um die Säuglinge und Mütter in der Dritten Welt, das ist doch rein politisch, das sind linke Romantiker / Sätze wie diese sind nicht zu erfinden und fallen beiläufig, bevor man zu Tisch geht und zur eigentlichen Konversation. Das Ressentiment gegen die Linke, das zur Zeit das öffentliche Klima in unsern Ländern prägt und nicht zögert, jedes linke Projekt gleichzusetzen mit Gulag oder Baader-Meinhof, ist als Ressentiment der Eigentümer-Macht plausibel, aber auch andern Leuten gefällig, da Ressentiment allemal bequemer ist als die Exerzitien politischen Bewußtseins. Daß längst eine Selbstkritik der Neuen Linken eingesetzt hat, kommt kaum zur Diskussion. Plausibel ist auch, daß die multinationale Eigentümer-Macht, traumatisiert durch die späten Sechzigerjahre, die Evidenz nämlich, daß Eigentum zwar Macht gibt, aber keine Autorität, die diese de facto-Macht legitimiert, in ihrer Terminologie sich besonders vaterländisch gibt: sie erhofft sich eine irrationale Autorität, indem sie, multinational im Geschäft, uns zu Hause lehrt, was schweizerisch ist oder American oder deutsch. Einer Macht ohne Autorität bleibt die Arroganz, die Verkündigung etwa: Sozialismus (den es noch gar nicht gibt) gehöre der Steinzeit an - um nicht einzugestehen, daß sie zum Zustand der Welt, der für alle, Inbegriffen die Eigentümer, bedrohlich ist, ihrerseits keine Alternative hat, allenfalls noch die defensive Fiktion, es sei die Umwelt (als Erdganzes) durch Management so einzurichten, daß der Mensch bleiben kann, wie er ist, die Gesellschaft wie sie ist.
ETWAS ÜBER DEN FRIEDEN SAGEN
Die Prognose, daß für das Menschengeschlecht dank seiner Technologie, die unwiderrufbar ist, der Konflikt mit der Umwelt größer wird als jeder denkbare Konflikt zwischen Nationen oder Macht-Blöcken, ist bekannt. Während die Abschreckungs-Strategie es den Völkern erschwert, der Vernichtung ihrer Lebensmöglichkeit auf diesem Planeten gemeinschaftlich zu begegnen, ist diese Vernichtung trotz Nicht-Krieg bereits im Gang. Was zur Zeit die Diplomatie erreicht unter dem labilen Gleichgewicht der Raketen-Arsenale, ein von Fall zu Fall unkriegerisches Arrangement zwischen den Machtblöcken, wobei die kleineren Staaten jeweils die Opfer zu bringen haben, ist nicht wenig: Erhaltung des Nicht-Krieges, eine Verlängerung der Gnadenfrist. Voraussetzung für den Frieden wäre der Abbau der Feindbilder. Wer kann sich das innenpolitisch leisten? Auf der ändern Seite: Gäbe man nicht die stereotypen Hinweise auf die inhumane Praxis im Privat-Kapitalismus, die schale Schadenfreude über Arbeitslosigkeit anderswo, Kriminalität anderswo usw., wie trüge die Bevölkerung arbeitssam und stumm die Mißwirtschaft des Staatskapitalismus und die totale Entmündigung des Staatsbürgers? Auf unserer Seite: Wie ließe sich Herrschaft erhalten ohne das Feindbild, das die Existenz-Angst des Einzelnen in einer Gesellschaft mit rechtsstaatlich geschützter Ausbeutung ummünzt in die gemeinschaftliche Angst vor der Sowjetunion? Also Feindbilder, die innenpolitisch benötigt werden.
Zum Teil (aber nur zum Teil) haben die Feindbilder eine historische Berechtigung; Völker haben mit andern Völkern ihre leidvolle Erfahrung gemacht, die Polen und die Tschechoslowaken zum Beispiel mit den Deutschen und mit den Russen, und es besteht ein natürliches Mißtrauen, das nur langsam abzutragen ist durch eine neue Erfahrung miteinander. Das ist möglich; die Bundesrepublik Deutschland ist nicht Hitler-Deutschland. Die Sorge, eine Politik der Entspannung (einer neuen Erfahrung miteinander) führe nicht zum Frieden, sondern lediglich zur Schwächung der eignen Macht-Position, ergibt sich aus der Logik der Macht-Politik: sie sucht Macht-Expansion zwar ohne Krieg, aber durch Drohung mit dem Krieg. Dafür braucht sie vor allem ein Feindbild andrer Art: das Feindbild, das nicht auf Erinnerung beruht, sondern auf Antizipation. Die Sowjetunion, zum Beispiel, hat das amerikanische Volk nie überfallen; man war sogar verbündet. Merkwürdigerweise sind es die antizipatorischen Feindbilder, die am allerschwersten sich auflösen lassen; sie sind in die Zukunft gestellt. Wo es um System-Hegemonie geht, ist das Feindbild nicht mehr nationalistisch: Die welsche Tücke, Das perfide Albion, Die Germanischen Horden usw., das mobilisiert nicht mehr. Die verbissenste Feindbild-Paarung in Europa (wenn wir absehen von den tragischen Iren) besteht zwischen den beiden deutschen Staaten; eine demonstrative Animosität, schmerzlich durch verwandtschaftliche Bindung und durch Vernunft kaum abzubauen, da sie, so vermute ich, mit einer Identitätsnot zu tun hat; wie Karl Jaspers es 1958 an dieser Stelle ausgesprochen hat: »Beide Regime haben ihren Grund im Willen der Besatzungsmächte.« Es wäre nachzutragen: beide sind die Musterschüler ihrer System-Schutzmächte geworden, beide im Begriff, ihren System-Bundesgenossen gegenüber sich als Präzeptor zu sehen.
Unsere Frage:
Wenn wir von Frieden reden, und gesetzt den Fall, wir glauben an seine Möglichkeit: wie stellen wir uns den Frieden vor? 1946 in Frankfurt am Main, als Gast bei ausgebombten Deutschen, verstand ich unter Frieden ganz einfach: Keine Bomben mehr, keine Siege mehr, Entlassung von Kriegsgefangenen. In Prag, wo es kaum Trümmer gab, nach einem Besuch in Theresienstadt, wo ich noch den Galgen sah und Tausende von Tüten mit menschlicher Asche, schien die Antwort auch einfach: Friede als Ende der Angst, keine Uniformen der Fremdherrschaft. In Warschau, 1948, hörte ich nach einem stundenlangen Gang durch Trümmerstille plötzlich das Gedröhn von Niethämmern an den ersten Pfeilern einer neuen Brücke über die Weichsel: Der Friede! Dort wie hier das Gespräch (bei halben Zigaretten) mit Zeitgenossen, die nichts besaßen außer der großen Hoffnung: aus den Ruinen werde hervortreten der neue Mensch. Die einen erwarteten ihn als Kommunist, die ändern als Christ. Nun wissen wir: Der neue Mensch ist nicht angetreten. Unsere vernunftsmäßige Ablehnung des Krieges als Mittel der Politik besagt noch nicht, daß wir friedensfähig sind. Gesellschaften mit Gewalt-Struktur mögen sich den Nicht-Krieg wünschen; der Friede widerspräche ihrem Wesen. Da keine Herrschaft je eingestehen wird, daß sie eine Armee auch braucht, um sie unter Umständen gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen, ist sie zwecks Tarnung dieser Armee-Funktion gezwungen zu einer Rüstung, die das Vaterland vor aller Welt zu schützen verspricht; also durch diese Rüstung wiederum gezwungen zur Pflege des Feindbildes, das solchen Kostenaufwand und Verschleiß rechtfertigt, was keineswegs heißt, daß jemand den Dritten Weltkrieg wünscht. Nur: die Rüstung ist da, die den Nachbarn enerviert und sein Feindbild bestätigt, und damit das Wettrüsten, wobei jedes Feindbild immer auch das eigne Wesen verrät: wie soll denn ein Erpresser von Geblüt je zu dem Vertrauen gelangen, der andere sinne nicht auf Erpressung? Was in diesem Teufelskreis die wissenschaftliche Friedensforschung leistet: sie kalkuliert das Risiko solcher Macht-Politik; unterrichtet über die technologischen Innovationen, die eine Revision der Strategie verlangen, errechnet sie die im Augenblick reale Chance für den Nicht-Krieg zwischen friedensunfähigen Gesellschaften, ohne allerdings eine Garantie geben zu können, daß es nicht aus irgendeinem unerforschten Grund oder auch nur durch eine platte Havarie (zum Beispiel eine plötzliche Vernunftsschwäche auf der gegnerischen Seite, eine Stupidität in der gegnerischen Kalkulation) trotzdem losgeht morgen oder übermorgen. Eine friedensfähige Gesellschaft wäre eine Gesellschaft, die ohne Feindbilder auskommt. Es gibt Phasen, wo wir nicht ohne Auseinandersetzung auskommen, nicht ohne Zorn, aber ohne Haß, ohne Feindbild: wenn wir (einfach gesprochen) glücklich sind oder zumindest lebendig - zum Beispiel durch eine Art von Arbeit, die nicht nur Lohn einbringt, sondern Befriedigung (die nicht entfremdete Arbeit), und durch eine Art des Zusammenlebens von Menschen, das Selbstverwirklichung zuläßt. Was meint Freiheit, ein so mißbrauchbares Wort, im Grunde anderes? Freiheit nicht als Faustrecht für den Starken, Freiheit nicht durch Macht über andere. Selbstverwirklichung; sagen wir: wenn es möglich ist, kreativ zu leben. Wie viele Menschen haben in den vorhandenen Gesellschaften aber die Möglichkeit, kreativ zu leben? Das ist durch Wohlstand allein noch nicht gegeben . . . Ob der Überlebenswille der Gattung ausreichen wird zum Umbau unsrer Gesellschaften in eine friedensfähige, weiß ich nicht. Wir hoffen. Es ist dringlich. Das Gebet entbindet nicht von der Frage nach unserem politischen Umgang mit dieser Hoffnung, die eine radikale ist. Der Glaube an eine Möglichkeit des Friedens (und also des Überlebens der Menschen) ist ein revolutionärer Glaube.
HOCHGESCHÄTZTE VERSAMMLUNG
Ich danke dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels für die Verleihung einer Würde, die zu tragen ich versuchen will. Ich danke Hartmut von Hentig mit der Versicherung, daß ich nicht bloß das Lob gehört habe, sondern auch seine erweiternden Gedanken, seinen Appell zu einer Wiederherstellung der Politik durch praktizierende Humanität. Ich danke den deutschen Lesern. Einer der ersten war Peter Suhrkamp: Zuspruch mit Maß, die Bereitschaft zur Anerkennung als Vorschuß, Kritik nicht aus Geiz, sondern aus der generösen Erwartung, einmal könnte es ja gelingen, Zustimmung und Widerspruch als Herausforderung, den eignen Standort in der Zeitgenossenschaft zu suchen, dafür danke ich den Lesern in beiden deutschen Staaten. Ich danke Ihnen, Damen und Herren, für Ihre höfliche Anwesenheit heute. Ich bedanke mich herzlich.
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck und jede andere Art der Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen, die urheberrechtlich nicht gestattet ist, werden verfolgt. Anfragen zur Nutzung der Reden oder von Ausschnitten daraus richten Sie bitte an: m.schult@boev.de
Max Frisch
Dankesrede des Preisträgers
Chronik des Jahres 1976
+++ In der Frankfurter Rundschau wird Anfang Januar 1976 ein Gedicht mit dem Titel Artikel 3 von Alfred Andersch veröffentlicht, in dem er scharfe Kritik an der Praxis des Radikalenerlasses in der Bundesrepublik übt. +++ Der Bundestag verabschiedet im Februar ein Reformgesetz zum Paragraphen 218. Danach wird bei einem Schwangerschaftsabbruch in den ersten drei Monaten nach der Empfängnis bei ethischer, medizinischer oder sozialer Notlage der Frau Straffreiheit gewährt. +++ Am 9. Mai wird Ulrike Meinhof erhängt in ihrer Zelle aufgefunden. Laut Angaben der Gefängnisleitung beging sie Suizid. +++
In Kambodscha wird Anfang April der Führer der radikalkommunistischen Roten Khmer, Khieu Samphan, neues Staatsoberhaupt. +++ Ministerpräsident wird Pol Pot. Im Verlauf der folgenden radikalen Umgestaltung der Gesellschaft werden zwischen ein und zwei Millionen Menschen ermordet. +++ Im Soweto bei Johannesburg brechen Mitte Juni schwere Anti-Apartheid-Unruhen aus. Bei den Auseinandersetzungen sterben mehr als 170 Menschen, tausende Schwarze werden inhaftiert, vor allem Anhänger des verbotenen ANC, dessen Führer Nelson Mandela seit 1962 inhaftiert ist. +++ Die Anti-Atomkraft-Bewegung formiert sich angesichts der Teilgenehmigung für den Bau des Kernkraftwerkes im niedersächsischen Brokdorf. Bei einer Demonstration Ende Oktober vor dem Baugelände kommt es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. +++ Während einer Tournee des Liedermachers Wolf Biermann durch die Bundesrepublik beschließt das Politbüro der DDR im November dessen Ausbürgerung. Begründet wird die Entscheidung damit, dass sich sein Programm gegen die DDR und den Sozialismus richte. In einer Petition protestieren dreizehn führende Intellektuelle der DDR gegen die Ausbürgerung. +++
Biographie Max Frisch
Der am 15. Mai 1911 in Zürich geborene Max Frisch muss wegen des Todes seines Vaters das Germanistikstudium abbrechen. Er arbeitet daraufhin als freier Mitarbeiter für die Neue Züricher Zeitung und reist 1933 in deren Auftrag erstmals ins Ausland. Seine Reise-Erfahrungen verarbeitet er in späteren Werken.
1934 erscheint sein erster Roman, Jürg Reinhart. Zwei Jahre später beginnt Frisch ein Architekturstudium. Er eröffnet 1942 ein Architekturbüro in Zürich. Schon im ersten Jahr gewinnt er den ersten Preis in einem städtischen Wettbewerb für den Bau einer Freibadanlage, die heute als »Max-Frisch-Bad« unter Denkmalschutz steht. 1955 gibt er das eigene Architekturbüro auf, als ihm mit dem Roman Stiller ein internationaler Bucherfolg gelingt.
Kritiker und Leser sind gleichermaßen beeindruckt, wie Frisch mit Romanen wie Homo Faber (1957) und Dramen wie Biedermann und die Brandstifter (1958) die existentiellen Probleme des Individuums der postmodernen Gesellschaft thematisiert. So gehört er, neben Friedrich Dürrenmatt, zu den wichtigsten Vertretern der Schweizer Nachkriegsliteratur.
Politisch entwickelt sich Frisch nach 1945 zum Wortführer einer schweizerischen linken Intelligenz und zu einer Leitfigur der europäischen Sozialdemokratie.
Max Frisch stirbt am 4. April 1991 im Alter von 79 Jahren.
Auszeichnungen
1989 Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf
1986 Neustadt International Prize for Literature der University of Oklahoma
1985 Ernennung zum ausländischen Ehrenmitglied der American Academy of Arts and Sciences
1985 Commonwealth-Preis (Chicago)
1984 Ernennung zum Commandeur dans l’ordre des arts et des lettres
1979 Ehrengabe aus dem Literaturkredit des Kantons Zürich (abgelehnt)
1976 Friedenspreis des Deutschen Buchhandels
1973 Großer Schillerpreis der Schweizerischen Schillerstiftung
1965 Schiller-Gedächtnispreis des Landes Baden-Württemberg
1965 Jerusalempreis für die Freiheit des Individuums in der Gesellschaft
1962 Großer Kunstpreis der Stadt Düsseldorf
1958 Literaturpreis der Stadt Zürich
1958 Georg-Büchner-Preis
1958 Charles-Veillon-Preis der Stadt Lausanne
1955 Schleußner-Schueller-Preis des Hessischen Rundfunks
1955 Gesamtwerkspreis der Schweizerischen Schillerstiftung
1954 Wilhelm-Raabe-Preis der Stadt Braunschweig
1945 Preis der Welti-Stiftung für das Drama »Santa Cruz«
1942 Erster Preis in einem Architekturwettbewerb der Stadt Zürich
1940 Einzelwerkpreis für »Blätter aus dem Brotsack« der Schweizerischen Schillerstiftung
1938 Conrad-Ferdinand-Meyer-Preis der Stadt Zürich
1935 Einzelwerkpreis für »Jürg Reinhart« der Schweizerischen Schillerstiftung
Bibliographie
Homo faber. Ein Bericht
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1957, Neuausgabe 1977, Taschenbuch, 208 Seiten, ISBN: 978-3-518-36854-1
Biedermann und die Brandstifter. Ein Lehrstück ohne Lehre. Mit einem Nachspiel
(Uraufführung am 29. März 1958 am Zürcher Schauspielhaus, Regie: Oskar Wälterlin); Suhrkamp, Frankfurt am Main 1958, Neuausgabe 1996, Taschenbuch, 96 Seiten, ISBN: 978-3-518-39045-0
Mein Name sei Gantenbein. Roman
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1964, Neuausgabe 1975,Taschenbuch, 304 Seiten, ISBN: 978-3-518-36786-5