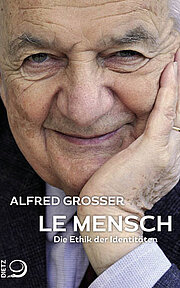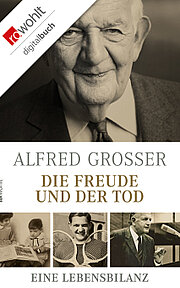Der Stiftungsrat für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels wählt den Publizisten, Soziologen und Politikwissenschaftler Alfred Grosser zum Träger des Friedenspreises 1975. Die Verleihung findet während der Frankfurter Buchmesse am Sonntag, 12. Oktober 1975, in der Paulskirche zu Frankfurt am Main statt. Die Laudatio hält Paul Frank.
Begründung der Jury
Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verleiht der Börsenverein im Jahre 1975 Alfred Grosser.
Berufen zum Mittler, entschlossen, für den Frieden zu wirken und zu streiten, ein Sucher nach der Ethik und der Wahrheit, durchdrungen von der Notwendigkeit des nie abreißenden Dialogs zwischen Franzosen und Deutschen, zwischen Gläubigen und Ungläubigen, zwischen Europäern und den Menschen anderer Kontinente, wurde er zum überzeugenden, unbestechlichen Mahner.
Reden
Brücken zu schlagen zwischen den Völkern, zwischen der französischen und der deutschen Jugend, Freundschaft zu stiften zwischen den Nationen, die Grundlagen zu schaffen für Versöhnung und Frieden, das sind die Anliegen, für die dieser engagierte Europäer kämpft.
Rolf Keller - Grußwort
Rolf Keller
Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
Grußwort
Herr Bundespräsident, meine Damen, meine Herren. Lieber Max Tau, wenn ich Ihren, den Namen des Mannes, dem der Buchhandel als erstem den Friedenspreis verlieh, als einzigen nenne, so stellvertretend für die heute anwesenden Träger dieser Auszeichnung und die vielen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, der Kultur, der Wissenschaft, der Wirtschaft und die Freunde des Buches.
Daß Bücher die Welt verwandeln, daß sie ihre Leser bessern oder ändern, das ist der Wunsch und der Traum von Autoren und Verlegern.
Sicher ist, sie - die Bücher - beeinflussen Kopf und Aug, bilden und lenken. Und hier ist ein Mann, dessen Waffe der Geist, das Wort und die Schrift ist. Er versucht in seinen Büchern unermüdlich, den Einfluß, den das gedruckte Wort nur haben kann, zu nutzen. Zu nutzen für das Vertrauen der Menschen zueinander, über die Grenzen der Länder, der Sprache oder des Glaubens hinweg.
Mit Alfred Grosser ehrt der Buchhandel alle, die mit der Schrift für den Frieden eintreten. Sie, Herr Grosser, als beispielhaften, unbestechlichen, unbequemen Mahner, als Mittler, Rufer nach Versöhnung, nach Brücken des Verstehens und nach Frieden und Vernunft, auszuzeichnen und Ihr Wirken herauszuheben, Ihren Mut und Fleiß und Ihre Zähigkeit zu würdigen, mit denen Sie Ihr von uns allen ersehntes Ziel erstreben, das war einmütiger Wunsch und das Anliegen des Stiftungsrats des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.
Professor Dr. Alfred Grosser hat als Hochschullehrer und Autor in Vorträgen und Publikationen für das Verstehen der Menschen untereinander, über die Grenzen der Länder, der Sprachen oder des Glaubens hinweg, geworben. Das Wesen der Demokratie, unsere geistige Verantwortung für Europa, die Verpflichtung, die uns unsere Kultur und Geschichte auferlegt, die politische Ethik sind Gegenstand seiner Forschung und seines Wirkens.
Brücken zu schlagen zwischen den Völkern, zwischen der französischen und der deutschen Jugend, Freundschaft zu stiften zwischen den Nationen, die Grundlagen zu schaffen für Versöhnung und Frieden, das sind die Anliegen, für die dieser engagierte Europäer kämpft.
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck und jede andere Art der Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen, die urheberrechtlich nicht gestattet ist, werden verfolgt. Anfragen zur Nutzung der Reden oder von Ausschnitten daraus richten Sie bitte an: m.schult@boev.de
Rolf Keller
Grußwort des Vorstehers
Mittler zu sein zwischen Frankreich und Deutschland bedeutet, die ganze Last einer tragischen Geschichte von Mißverständnissen und versäumten Gelegenheiten zu akzeptieren und den Mut und die Hoffnung nicht zu verlieren.
Paul Frank - Laudatio auf Alfred Grosser
Paul Frank
Auf den Friedenspreisträger 1975
Laudatio auf Alfred Grosser
Alfred Grosser wird heute durch die Verleihung des Friedenspreises des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels geehrt. Das Gremium, das diese Entscheidung getroffen hat, ehrt sich damit auch selbst.
Alfred Grosser ist am 1. Februar 1925 als Deutscher in diesem Frankfurt am Main geboren. Zurückgekehrt ist er als Franzose. Er hat die Wahlheimat Frankreich nicht aus freien Stücken betreten. An der Hand seiner Eltern, die ein unmenschliches Regime aus sogenannten rassischen Gründen aus dem Vaterland hinausgeworfen hatte, hat er die französische Grenze auf der Flucht überschritten.
Doch sollte niemand auf den Gedanken kommen, es werde heute ein Friedenspreis zur Wiedergutmachung verliehen. Das, was Grosser und seiner Familie geschehen ist, kann nicht mehr gutgemacht werden. Die Leistung, die der Preis auszeichnen will, hat eher zufällig mit der Vergangenheit zu tun. Sie hat sich davon emanzipiert, sich sozusagen über sie erhoben. Aus Trümmern ist die gute Saat aufgegangen.
Hören wir selbst, wie sich Alfred Grosser mit der Vergangenheit, mit ihrem schlimmsten Teil, der Judenvernichtung, auseinandergesetzt hat. Er schreibt: »Nie, zu keiner Zeit und in keinem Land (sind) Tod und Leiden in solchem Ausmaß, mit soviel Methode und mit solchem Bestreben, die Opfer vor ihrer Vernichtung zu erniedrigen, gewollt und organisiert worden ...«
Er fährt fort: »Stimmt das? Der >Chruschtschow-Bericht< hat im Jahre 1956 bestätigt, daß auf dem Staatsgebiet der Sowjetunion auf Befehl Stalins die Bevölkerungen ganzer Gebiete ausgerottet worden sind.
Warum sollte man also die Verbrechen verschieden beurteilen? Unter der Bedingung, daß man es vorsichtig verwendet, scheint ein einziges Argument von Gewicht zu sein, das der inneren Logik einer Ideologie und eines politischen Systems.«
Unzählige Male begegnet einem diese Gedankenbewegung in Alfred Grossers Schriften: Das eine ist richtig, aber ein anderes ist ebenso richtig, aber es gibt, genau betrachtet, Unterschiede. Sein leidenschaftlicher Wille, immer das Recht - oder das Unrecht - beider Seiten zu sehen, das der Deutschen und der Franzosen, der Gläubigen und der Ungläubigen, der Europäer und der Amerikaner, seine Überzeugung, daß man die Fähigkeit haben müsse, sich mit den Augen des anderen zu sehen, kurz, sein Wille zur Gerechtigkeit, sie hängen wohl mit seiner Herkunft zusammen.
Es ist indessen kein vom Schicksal vorgezeichneter Weg gewesen, der Alfred Grosser von Frankfurt heute hierher in die Paulskirche in Frankfurt geführt hat. Daß er zum Mittler zwischen unseren, zwischen seinen Völkern wurde, dazu bedurfte es der Kräfte des Geistes und des Herzens, die dem Haß widerstanden.
Viel und Entscheidendes hat sein Elternhaus dazu beigetragen. Sein Vater, Professor Dr. Paul Grosser, muß ein sehr bemerkenswerter Mann gewesen sein. Er war Kinderarzt. Nach seinem Tod schrieb die Frankfurter Zeitung am 9. Februar 1934: »Im Jahre 1919 wurde er Privatdozent an der Frankfurter Universität. Er hatte vorher während der ganzen Dauer des Weltkrieges als Kriegsteilnehmer im Felde gestanden und das EK I. erworben. In den folgenden Jahren war er einer der erfolgreichsten Kinderärzte Frankfurts ... Seine menschlichen Eigenschaften haben ihm ungewöhnliches Vertrauen unter den Ärzten und der übrigen Bevölkerung der Stadt verschafft.«
Dieser Nachruf ehrt die damalige Frankfurter Zeitung. Die Zeiten waren vorbei, in denen man ein gutes Wort über einen ehemaligen jüdischen Mitbürger schreiben konnte. Die Menschlichkeit dieses Mannes muß so ungewöhnlich gewesen sein, daß sie die Furcht vor der Tyrannei besiegte. Jude, Kinderarzt, Kriegsdienst, Eisernes Kreuz - taucht nicht bei uns, den Älteren, die Erinnerung auf an jüdische Familien, die wir gekannt haben, die Erinnerung an eine stille, kultivierte Humanität, an Menschen, die dieses Land liebten, weil sie seine Kultur liebten? Wo fand sie, unsere Kultur, zeitweilig eine bessere Herberge als in den Häusern unserer jüdischen Mitbürger? In unserem Land war damals die Hybris gescheiterter Existenzen an der Macht. Sie bestimmte, was deutsch zu sein hatte. Vorstellungen von monumentaler Dummheit und schließlich auch Bestialität waren das Produkt verwirrter Gehirne. Der Rang eines Menschen hänge von seiner »Rasse« ab, und die beste Rasse sei die »deutsche«, die »germanische« - und jede andere, und insbesondere die »jüdische«, sei minderwertig und daher auszurotten. Da die Machthaber nichts im Kopf und nichts im Herzen hatten, mußte für sie sich der Mensch wohl durch sein Blut ausweisen.
Und so mußte die deutsche Familie Grosser fliehen.
Man spricht so viel von den Verlusten, die die Vertreibung und Ermordung der Juden dem deutschen Geist zugefügt hat, man zählt die Nobelpreisträger und Weltberühmtheiten, um zu zeigen, wie unsinnig, irrsinnig der Rassenwahn war. Nur selten jedoch machen wir uns klar, welch ungeheurer Vorrat an menschlicher Güte von den braunen Stiefeln zertrampelt wurde. Dies ist ein Verlust, den wir nicht ersetzen können. Das bringt uns keiner wieder heim.
1937 werden Frau Lily Grosser und ihre Kinder französische Staatsbürger. Alfred Grosser besucht das Gymnasium in St. Germain-en-Laye. Er sagt dazu: »Unauslöschlich hat mich die Kultur der Nation, in der ich aufgewachsen bin, geprägt, und ich würde zum Beispiel anders denken, wenn meine Eltern nach den Vereinigten Staaten und nicht nach Frankreich ausgewandert wären.«
Deutschland und Frankreich also. Dieses »und«, weit über den literarischen und kulturellen Bereich hinaus, wird sein Leben bestimmen. Der Franzose Alfred Grosser kann Deutschland von draußen sehen - und so heißt ein Buch von ihm geradezu: »Die Bonner Demokratie. Deutschland von draußen gesehen«. Aber sein Geburtsland, sein Vaterhaus gibt ihm die Möglichkeit, Deutschland von »innen« zu sehen. Und umgekehrt: Der Franzose sieht Frankreich von innen, der Frankfurter vermag es von außen anzuschauen. Welch ein Zufall des Namens übrigens. Frankfurt. Heißt nicht Furt: Übergang ins Land der Franken? Der Übergang, die Brücke: das ist sein Platz.
Dieser junge Mann hat dann in all diesen Jahren Deutsch studiert. Zweimal vertrieben, den Vater und die Schwester verloren, wegen seiner »Rasse« verfolgt, die Verwandtschaft gemordet: und er studiert Deutsch, er beschäftigt sich mit deutscher Literatur. Wie ist das zu verstehen?
Alfred Grosser schreibt darüber: »Ein paar Wochen vor der Befreiung von Marseille hatte ich eine Nacht lang gegen Racheinstinkte angekämpft: Die BBC hatte gemeldet, daß die Häftlinge von Theresienstadt nach Auschwitz transportiert worden seien, um dort vergast zu werden; die Nachricht hatte für mich im Hinblick auf einen Teil meiner Familie eine sehr konkrete Bedeutung, aber am anderen Morgen war ich sicher, endgültig sicher, daß es für mich nie kollektiven Haß geben würde und daß ich nie eine menschliche Gruppe für Verbrechen verurteilen würde, die von einzelnen begangen wurden, auch wenn diese noch so zahlreich waren.«
Er war sicher, endgültig sicher. Lassen wir es so stehen. Er ist es geblieben, bis heute.
Manche französischen Germanisten trugen, gelinde gesagt, wenig dazu bei, Pauschalurteile zu verhindern oder abzubauen. Wie manche deutschen Romanisten, vielleicht nicht ganz so schlimm, sahen sie ihre Funktion darin, Vorurteile wissenschaftlich zu untermauern. Es wird mir immer bemerkenswert vorkommen, wie Alfred Grosser sich seinen Blick nicht verwirren ließ durch kenntnisreiche und zum Teil weitberühmte Fachkollegen.
Über den Völkern wirken die wirklich Großen des Geistes; in der Mittelschicht halten sich die sogenannten Gebildeten auf, und die Grundlage, der Nährboden für alles sind die Völker.
Ich möchte stark vergröbernd sagen: Gäbe es die »Gebildeten« nicht, dem Verständnis der Völker wären Tür und Tor geöffnet. Ein wohletabliertes Vorurteil bei Lehrern und Professoren, Doktoren und Advokaten, Journalisten und Politikern etc. ist dauerhafter als Marmelstein.
Dies aber ist genau die Schicht, die die Führungspositionen im Staat und in der Gesellschaft und Erziehung besetzt hält. Und die ihre Vorurteile in den Wald des Volkes hineinschauen läßt, von wo sie dann als vox dei wieder zurückschallen.
Jeder klare, selbständige Geist haßt Vorurteile, das ist sein Kennzeichen.
Lassen Sie mich das verdeutlichen an der Person des größten Frankfurters. Gefragt, warum er in den Freiheitskriegen keine Kriegslieder geschrieben habe, antwortete Goethe, daß er dazu die Franzosen hätte hassen müssen. Aber er haßte die Franzosen nicht. »Wie hätte auch ich, dem nur Kultur und Barbarei Dinge von Bedeutung sind, eine Nation hassen können, die zu den kultiviertesten der Erde gehört und der ich einen so großen Teil meiner eigenen Bildung verdankte. Überhaupt ist es mit dem Nationalhaß ein eigenes Ding. Auf den untersten Stufen der Kultur werden sie ihn immer am stärksten und heftigsten finden. Es gibt aber eine Stufe, wo er ganz verschwindet und man gewissermaßen über den Nationen steht und man ein Glück oder Wehe seines Nachbarvolkes empfindet, als wäre es dem eigenen begegnet. Diese Kulturstufe war meiner Natur gemäß.«
Dies ist ein Beispiel, das sich beliebig vermehren ließe. Das gleiche gilt natürlich in umgekehrter Richtung. Das gleiche gilt für alle Bereiche der Kultur. Wissen die Völker davon? Konkret gefragt: Haben es die Professoren ihren Studenten, die Lehrer ihren Schülern gesagt? Nein, das haben sie nicht getan. - Es wäre auf beiden Seiten an der Zeit, daß man es lehrte und lernte.
Für Alfred Grosser ist das nichts Neues. Für ihn ist es das Selbstverständlichste der Welt. Er kennt beide Seiten. Er schätzt sie, er braucht sie.
Aber wir ehren heute keinen Germanisten, wir ehren einen Politologen, einen Publizisten, einen Mann, der sich um das Verständnis der innen- und außenpolitischen, der ökonomischen, der sozialen, der rechtlichen und verfassungsmäßigen Zusammenhänge in beiden Ländern bemüht, sie klärt, sie darstellt, für Verständnis wirbt. Die Germanistik liegt lange hinter ihm. Die Beschäftigung mit der Literatur war ihm nicht tief und nicht breit genug, um in jene Bereiche vorstoßen zu können, wo sich die Völker begegnen, sich bekämpfen oder sich verstehen.
In einem Artikel vom 31. Oktober 1947 im »Combat« gibt Alfred Grosser so etwas wie eine Erklärung. Er hat eine Deutschlandreise gemacht. Frankreich hatte Theatergruppen, Quartette, Vortragende, Ausstellungen in seine Besatzungszone geschickt. Man sagt ihm schöne Sachen darüber. Er schreibt: »Aber glaubt man tatsächlich, daß das alles genügt, um bei den jungen Deutschen, ich will nicht einmal sagen, die Liebe zu Frankreich, sondern nur das Verständnis für die französischen Probleme zu wecken, und ganz allgemein für die menschlichen Probleme unserer Zeit? In Wirklichkeit ist die kulturelle Anstrengung sehr oberflächlich. Es ist gut, den »Trojanischen Krieg« zu zeigen, aber es wäre noch besser, wenn man den jungen Deutschen Bücher beschaffen würde, die es ihnen erlauben, sich zu unterrichten über das, was außerhalb vorgeht und gedacht wird. Solche Bücher gibt es indessen nicht in unserer Zone.«
Eine Artikelserie im »Combat« erscheint. Was ist das Wichtigste? Die Jugend! Die Jugend ist unschuldig an dem, was geschah, auch die deutsche: »Or, le jeune Allemand ne se tient pas pour responsable de la folie criminelle du régime hitlérien. En quoi il a raison. II n'y a pas de responsabilité collective pour les enfants et les adolescents.«
Da ist es wieder, das Credo Alfred Grossers, dessen er sicher ist, endgültig sicher. Er ruft dazu auf, der deutschen Jugend entgegenzukommen, ihr die Grenzen zu öffnen. Die Zeit dränge. Worauf wolle man warten?
Von 1948-1967 ist er ehrenamtlicher Generalsekretär des »Comité d'échanges avec l'Allemagne nouvelle« und Herausgeber der Zeitschrift »Allemagne«. Lange Zeit vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland hatten sich in diesem Comité prominente Franzosen von links bis rechts zusammengefunden, um in einem neuen Geiste nach Verständigung zu suchen mit einem neuen Deutschland.
Als dann die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1950 in der Person des unvergessenen Wilhelm Hausenstein die Türen in Frankreich einen Spalt breit zu öffnen suchte, da war Alfred Grosser einer der ersten, der uns einließ.
»Conversations franco-allemandes«, das war der Titel der ersten französisch-deutschen Podiumsgespräche in der Sorbonne, die Grosser veranstaltete. Die soziale, wirtschaftliche und politische Wirklichkeit der beiden Länder war ihr Thema.
Eine treue Arbeiterin für ein besseres Verständnis war die Mutter Alfred Grossers, Frau Lily Grosser. Niemand, der mit dieser gütigen Frau in Berührung kam, kann sie vergessen. Sie war hauptamtliche Sekretärin des Comités. Das war nicht nur ein Titel. Das war Arbeit. Frau Grosser war das, was man im Französischen die »cheville-ouvrière« nennt, die Seele des Comités. Und so mancher Deutsche erinnert sich mit Dankbarkeit an die mütterliche Betreuung, die er bei seinen ersten Nachkriegsschritten in Frankreich durch sie erfahren hat. Und all das, damit sich die Jugend des Landes, das ihr das Liebste genommen hatte, mit dem Lande verstehe, das sie als freie Bürgerin aufgenommen hatte.
Verdienste um die deutsch-französische Verständigung - damit schmücken sich viele. Ich wüßte nicht viele zu nennen, die soviel dafür getan haben. Lebte sie noch, sie stände heute hier neben ihrem Sohn, den sie in seinem Bemühen nicht nur nicht abhielt, den sie nicht nur gewähren ließ, sondern dem ihre Güte die unerschütterliche Gewißheit gab, daß er auf dem richtigen Wege war.
»Allemagne nouvelle«. Das war es, worauf unsere wenigen Freunde hofften, damals. Aber haben wir diesen Namen aufgegriffen? Zog unser Selbstverständnis nicht eine problematische Kontinuität einem neuen Anfang vor? So prangt heute der Name »Neues Deutschland« am Kopf der Staatszeitung der DDR. Auch Namen können Chancen sein. Diese wurde verspielt.
Es gab 1947 wenig Bücher, die den Franzosen zeigten, was die Deutschen dachten, es gab wenig Bücher, die Deutschen zeigten, was die Franzosen dachten. Gut, so mußte man welche schreiben. Alfred Grosser schrieb Artikel, er schrieb Bücher. Zeit und Einsicht und innere Konsequenz drängten ihn dazu. Er wußte: Es kommt nicht darauf an, die geistigen Spitzen der beiden Länder zu überzeugen. Es kommt darauf an, die Schichten darunter zu informieren, aufzuklären. Die kulturellen Vorurteile sind nur ein Ausdruck eines allgemeineren Vorurteils. Man kann kulturelle Vorurteile nur beseitigen, wenn man tiefer und breiter ansetzt.
Grosser sieht, daß es eine nationale Moral gibt, die die anderen Völker nach sehr strengen Maßstäben mißt, für das eigene, gleichartige Verhalten aber immer Entschuldigungen, Rechtfertigungen - auch moralische - findet und erfindet. Das ist sein Grunderlebnis im Verhältnis Deutschland-Frankreich. Hier ist der Punkt, wo er ansetzt. Verständigung aufgrund nationaler Ethiken ist nicht möglich.
Er verfolgt dabei immer das gleiche Ziel, uns klarzumachen, daß unsere Urteile zu simpel sind, daß die meisten Dinge nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern mehrere Seiten haben. Sein Sinn für Gerechtigkeit reicht bis in die Anmerkungen. An einer Stelle heißt es: »Das Te deum Bossuets, das den Erfolg der mit Folter und Galgen erreichten Zwangsbekehrung der Protestanten durch Ludwig XIV. pries, war von gleicher Art wie die unzähligen Te deum, mit denen Gott für die Siege über die Feinde gedankt wurde, auch wenn diese Katholiken waren.«
Anmerkung dazu: »Siehe z. B. die erschreckende Sammlung - deren französisches Äquivalent noch aussteht - von Heinrich Missala, >Gott mit uns<. Die deutsche katholische Kriegspredigt 1914-1918.«
»- deren französisches Äquivalent noch aussteht -«, das ist Alfred Grosser. Der Algerienkrieg gibt ihm Gelegenheit, die gleichen, unbequemen Fragen zu stellen. Wie heißt es doch so schön: Das eigene Nest zu beschmutzen. Daher kommt es, daß man ihm so unbedingt glaubt, wenn er sagt: Dieser oder jener Vorwurf gegen die Deutschen, die Franzosen ist gerechtfertigt oder nicht. Die Wirkung der Wahrhaftigkeit ist Glaubwürdigkeit.
So hat er gewirkt und so wirkt er weiter: mutig, unbestechlich, der Wahrheit auf der Spur, der Gerechtigkeit. Als ein Ungläubiger vermittelt er zwischen den Gläubigen, indem er ihrer Teilwahrheit seine umfassendere Wahrheit entgegenhält.
»Elemente einer Art aufklärerischer Vermittlungsarbeit« hat er bescheiden seine Berufung genannt. Mittler zwischen Deutschen und Franzosen.
Mittler zu sein zwischen Frankreich und Deutschland bedeutet, die ganze Last einer tragischen Geschichte von Mißverständnissen und versäumten Gelegenheiten zu akzeptieren und den Mut und die Hoffnung nicht zu verlieren.
Die Regierungen haben in der Unbekümmertheit der fünfziger Jahre für die differenziertere Art, mit der Grosser an das deutsch-französische Verhältnis herangegangen ist, wenig übrig gehabt. Dem Turmbau zu Babel gleich haben sie Plan um Plan, Gemeinschaft um Gemeinschaft aufeinandergetürmt. Nur das, worauf es im demokratischen Staatswesen letzten Endes ankommt, das Volk - oder die Völker - haben sie außer acht gelassen.
Ich spreche nicht von der Zustimmung der Deutschen zu fast jeder Art europäischer Einigungspolitik, wenn sie uns nur den Ausweg aus der unmittelbaren Vergangenheit eröffnete. Das war nur allzu gut zu verstehen.
Nein, ich spreche davon, ob wir aufmerksam, kritisch und skeptisch genug auf die Regungen des französischen Volkes geachtet haben. Ob wir uns die Mühe gemacht haben, abweichende oder die europäische Einigung gar ablehnende Stimmen zu verstehen, ihre Gedanken zu prüfen oder nachzuvollziehen.
Nein, es war einfacher und bequemer, Frankreich einzuteilen in Europäer und Antieuropäer. Es war einfacher und bequemer, einen Block von 20 % oder 25 % Kommunisten in der politischen Isolierung zu ignorieren, als die europäische Einigung auch als gesellschaftspolitische Aufgabe zu verstehen. Und es war einfacher, da vom »antiquierten französischen Nationalismus« zu sprechen, wo Frankreich mit seiner Vergangenheit nicht ins reine kommen konnte. Kein Volk hat in seiner politischen Literatur der vierziger und fünfziger Jahre soviel selbstzerfleischende, selbsterkennende Kritik geübt wie das französische; aber wir haben sie nicht zur Kenntnis genommen, ob es sich um »Les taxis de la Marne« oder um »La question« handelte. Die verletzte Seele Frankreichs hatte sich der Welt dargeboten; aber die Welt der Politiker zog es vor, Kommuniqués zu fabrizieren.
Wir bereiten uns darauf vor, den 20. Jahrestag der Rückkehr des Saargebiets zu begehen. Wir werden dies - und dessen bin ich sicher - in einem europäischen Geist tun. Aber wir sollten nicht vergessen, daß der Mann, der damals auf französischer Seite darauf bestanden hat, in die Vereinbarungen das Selbstbestimmungsrecht einzubauen und damit die Entscheidung des Volkes an der Saar erst ermöglicht hat, Pierre Mendés-France hieß. Ein Mann, den manche von uns wegen der Ablehnung der Europäischen Verteidigungs-Gemeinschaft in seiner Regierungszeit als Antieuropäer, wenn nicht noch Schlimmeres einzustufen pflegten. War es nicht auch gute europäische Politik, am Selbstbestimmungsrecht festzuhalten?
Ich meine, es ist mehr als die Verschiebung des europäischen Gleichgewichts, das den Franzosen und Deutschen erlaubt, die Schablonen der Vergangenheit abzustreifen und aufeinander zuzugehen. Nicht Secam und nicht Airbus und vielleicht nicht einmal der gemeinsame Agrarmarkt dürfen darüber entscheiden, sondern einzig und allein der Bürger beider Länder. Er muß es tun in jener kritischen Unbefangenheit, die uns Alfred Grosser aufzeigt. Sich mit den Augen des anderen sehen; unangenehmen Wahrheiten nicht ausweichen und sich nicht mit Schablonen begnügen, wo Neues entstanden ist.
Wir stehen, was Frankreich und Deutschland angeht, erst am Beginn einer Verständigung. Das ist die Wahrheit. Wenn wir heute den Französisch-Unterricht in unseren Schulen abbauen statt ihn zu fördern, so erleichtern wir nicht die künftige Kommunikation der beiden Völker. Es gibt noch unendlich vieles, was uns trennt. Es gibt Rückschläge. Aber wem kann ich das klarmachen, wenn wir, wie allerorts verkündet, schon befreundet, schon ausgesöhnt sind? Was bleibt noch zu tun, wenn alles schon erreicht ist?
Die großen und die leeren Worte. Gibt es ein Kommuniqué, in dem nicht steht, man habe in wesentlichen Fragen Übereinstimmung erzielt? Was heißt, man hat sich über das meiste nicht einigen können.
Warum spricht die Politik so oft eine uneigentliche Sprache? Glaubt man, daß die Wahrheit hinderlich, störend sei? Natürlich ist sie hinderlich, störend, lästig - aber sie befreit, sie verbindet; sie verbindet gerade dort, wo Unterschiede bestehen.
Diese verbindende Wahrheit fällt nicht nur vielen Deutschen, sondern auch vielen Franzosen schwer. Für sie ist Deutschland immer noch »outre-Rhin«, jenes undefinierbare, unheimliche Gebilde im Osten, ungesegnet von der einzig wahren Kultur und Denkungsart, der französischen. Immer noch werden französischer Klarheit und Logik germanische Verschwommenheit und Romantik entgegengehalten.
Auch das, was auf deutschem Boden nach 1949 an freiheitlichem und sozialem Rechtsstaat, an Neuem geschaffen wurde, hat dieses überkommene Bild vom Deutschen nicht wesentlich ändern können. Vielleicht müssen Deutsche und Franzosen erst einmal durch eine gemeinsame »résistance« hindurchgehen, damit sie wirklich zusammenfinden können. Résistance wogegen? Franzosen und Deutsche müssen sich gemeinsam dagegen wehren, daß die unkontrollierte Dynamik der modernen Industriegesellschaft die Freiheit und Menschlichkeit unserer europäischen Lebensformen zerstört. Und lassen Sie es mich freimütig bekennen: Hier vertraue ich, hier hoffe ich auf den Genius des kleinen Mannes in Frankreich.
Lieber Freund, Sie nehmen heute in Ihrer Geburtsstadt einen Friedenspreis entgegen. Es waren, äußerlich gesehen, sehr verschlungene Pfade, die Sie von Frankfurt nach Frankfurt führten. Für Sie war es ein sehr geradliniger Weg. Sie haben alles darangesetzt, die »Kohärenz« zwischen Denken und Leben, Sittlichkeit und Tat herzustellen.
Die Frage an uns lautet: Genügt es, danke schön zu sagen, einen Preis zu verleihen, sich an einem konsequent gelebten Leben zu erfreuen und im übrigen sich die Welt weiter drehen zu lassen? Genügt es, zu sagen: Schön, daß es solche Leute gibt, aber wir haben anderes zu tun, wir müssen zum Beispiel Politik machen oder das System verändern oder zur Verbreitung der Kultur beitragen etc. Und wir kehren mit der Preisverleihung als Alibi im Rücken zu unseren Pflichten zurück und denken, schreiben, handeln wie eh und je. Ganz gewiß wäre es nicht im Sinne des Geehrten, wenn diese Preisverleihung uns sicherer machte. Er haßt Sicherheiten, Erstarrung, Faulheit.
Es darf nicht das Privileg von Leuten wie Alfred Grosser sein, die Dinge beim Namen zu nennen. Er will seine Publikationen nicht als politologische Lektüre verstanden wissen, sondern als eine Aufforderung, so kritisch, so objektiv, so wahrheitsliebend zu fragen und zu denken wie er, und es auch dann auszusprechen, wenn die Wahrheit wie jeder echte Heilungsprozeß wehtut.
Der Bürger begreift die harte Wahrheit. Er geht ihr nicht aus dem Wege. Politisch führen heißt zum guten Teil: die Wahrheit sagen, den Mut haben, dem Volk die Wahrheit zuzumuten. Denn wie sieht der demokratische Bürger aus, von dem unsere Verfassung ausgeht und auf den sie zielt? Dieser Bürger ist ein kritischer Mensch, der prüft und wägt, der den Mut hat, seine persönliche Entscheidung zu treffen, klaren Blicks, nicht festgelegt von Ideologien, der Argumenten zugänglich ist, der nicht immer recht haben will, kurz, der freie, selbstdenkende, selbstverantwortlich handelnde Mensch.
Diese Bürgertugenden hat Alfred Grosser unerschrocken gelebt. Wenn wir sie in unserem Verhältnis zu Frankreich - und zu allen anderen und unter uns selbst - anwenden, geben wir dem Frieden eine Chance. Es hat seinen guten Sinn, daß Alfred Grosser in diesem ehrwürdigen Raum der deutschen Demokratie einen Friedenspreis erhält.
Ich beglückwünsche ihn dazu von Herzen, seine Frau und seine vier Söhne.
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck und jede andere Art der Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen, die urheberrechtlich nicht gestattet ist, werden verfolgt. Anfragen zur Nutzung der Reden oder von Ausschnitten daraus richten Sie bitte an: m.schult@boev.de
Paul Frank
Laudatio
Bis jetzt gibt es noch keine Anzeichen dafür, daß sich die Bürger in Angst von den demokratischen Parteien abwenden. Aber das ist kein genügender Grund, um unbesorgt zu sein.
Alfred Grosser - Dankesrede
Alfred Grosser
Die Bundesrepublik, der internationale und der innere Friede
Dankesrede
Dankbarkeit und Freude: daß ich beide Gefühle hier und heute empfinde, wird niemanden überraschen. So brauche ich nur kurz zu sagen, wie sehr ich allen danke.
Denen, die mich auserkoren haben. Dem, der die Pflichtübung des Lobes mit einer fruchtbaren kritischen Analyse im Sinne unserer langjährigen gemeinsamen Bestrebungen verbunden hat, und dem ich überhaupt für die Freundschaft dankbar bin, die nun seit einem Vierteljahrhundert besteht. Denen schließlich, die mir die Ehre erweisen, heute hier anwesend zu sein.
Wer und was ist nun soeben »preisgekrönt« worden? Es muß betont werden, daß ich als Stellvertreter dastehe. Stellvertretend für all jene Franzosen, die nach 1945 Deutschland und den Deutschen gegenüber die warme und tatkräftige Vernunft haben walten lassen und somit ihre Landsleute positiv beeinflußt haben. Für die unter ihnen, die sich durch Wort und Schrift eingesetzt haben, und noch mehr für die Unbekannten, die eine mühselige, zeit- und vor allem freizeitraubende Kleinarbeit vollbracht haben und noch vollbringen.
Aber nicht nur als Stellvertreter. Ich darf annehmen, daß durch die Preisverleihung ein besonderer Aspekt der Mittlerfunktion, die ich versuche auszuüben, besonders gutgeheißen wird. Nämlich mein ständiger Versuch, meine ständige Versuchung, auf die Entwicklung der Bundesrepublik etwas Einfluß auszuüben, indem ich die deutschen Verhältnisse für deutsche Leser und Hörer so darstelle, wie ich sie als wohlwollend besorgter Außenstehender sehe.
Ich betrachte den Preis als eine Ermutigung, mich auch weiterhin in der Bundesrepublik dem Vorwurf auszusetzen, ich mische mich in fremde Angelegenheiten ein. Was heißt da übrigens fremd? Es war doch gerade weil wir uns für die deutsche Zukunft mitverantwortlich fühlten, daß wir die Zusammenarbeit begannen und die gegenseitige Beeinflussung guthießen.
So darf ich annehmen, daß von mir keine schöngeistige Rede, keine tiefe philosophische Betrachtung über die Natur des Friedens erwartet wird, sondern Gedanken, die der Haltung entsprechen, für die man mir die Ehrung hat widerfahren lassen.
Das Thema liegt somit auf der Hand. Was bedeutet der Frieden für die Bundesrepublik? Der Frieden in der weiten Welt und der Frieden innerhalb ihrer Grenzen.
Ein paar Worte sind nun doch notwendig, um den Standpunkt zu verdeutlichen, von dem aus die bundesdeutsche Entwicklung beleuchtet werden soll.
Den Frieden schlechthin gibt es nicht, genausowenig wie es die Wahrheit schlechthin gibt oder die Objektivität. Kein Journalist, kein Sozialwissenschaftler ist objektiv. Aber es besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen denen, die selbstkritisch und selbsterzieherisch nach der Objektivität streben, und denen, die dies nicht tun. Gerade die, die wissen, wie unvollständig ihre eigene Objektivität ist, sind dadurch fähig, die Dinge unvoreingenommener zu betrachten und zu beschreiben als diejenigen, die wähnen, objektiv zu sein.
Es gibt keine absolute Wahrheit. Es gibt aber Dinge, die wahrer sind als andere. Und gerade die, die empfinden, daß sie nur Teilwahrheiten erreicht haben, wissen, daß die anderen, daß auch die Gegner einen Teil der Wahrheit vertreten und sind deshalb einer vollständigeren Wahrheit näher als jene, die wähnen, die Wahrheit zu besitzen, was sie beinahe notwendigerweise zur Beschränktheit und zur Intoleranz verleitet.
Es gibt keinen totalen Frieden, aber es gibt Strukturen und Verhalten, die friedensfördernder sind als andere. Situationen, die einem Frieden der Gerechtigkeit näher kommen als andere. Gerade die, die wissen, daß der bestehende Friede teilweise ein aufgezwungenes Sichzufriedengeben der Schwachen, der Benachteiligten beträgt, erkennen, daß neue Schritte zu einem besseren Frieden unternommen werden sollten. Diejenigen dagegen, die wähnen, in einem schönen Frieden zu leben, sind nur allzuoft Pharisäer, die nicht sehen, inwiefern dieser Frieden für andere das Festfrieren, das Erstarren einer Ungerechtigkeit bedeutet.
Keine Gesellschaftsordnung ist so vollkommen, daß sie nicht von einem Teil der Menschen, die ihr angehören, zu Recht als eine Unordnung betrachtet werden könnte. Kein internationaler oder innerer Frieden ist so vollkommen, daß die Abwesenheit der blutvergießenden Gewalt nicht teilweise einer Resignation zuzuschreiben wäre, nämlich der Resignation derer, die an den Mitteln verzweifeln, die ihnen in der Friedensordnung zur Verfügung stehen, um ihr schlimmes Schicksal zu verändern.
1953 wurde der Frieden in Ostberlin gebrochen, 1956 in Budapest. Heute herrscht wieder Friede in der DDR und in Ungarn. Mit wieviel Resignation? Vor zehn Jahren gab es Brand und Blutvergießen im schwarzen Stadtteil Watts von Los Angeles. Heute herrscht dort Friede. Vermindert wurden Elend und Ungerechtigkeit nicht.
Bei einer Ost-West-Begegnung in Leningrad beklagte ich, daß der Prager Frühling 1968 direkt in einen dauerhaften Winter verwandelt worden sei. Darauf wurde mir entgegnet: »Das Bild stimmt nicht. Es sollte heißen: im Frühling kann geschehen, daß Flüsse über ihr Bett hinaustreten. Dabei werden sie schmutzig. Wir werden von jetzt ab dafür sorgen, daß sie sauber bleiben!«
Sauber wie alle Friedensordnungen, die auferlegt werden, indem man die »Störenfriede« ausschaltet. Sauber z. B. wie die Gesellschaftsstrukturen, die Bismarck als innere Friedensordnung bewahren wollte, als er 1878 das »Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie« schuf, dessen erster Artikel folgendermaßen lautete:
Vereine, welche durch sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische Bestrebungen den Umsturz der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung bezwecken, sind zu verbieten.
Dasselbe gilt von Vereinen, in welchen sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische, auf den Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen in einer den öffentlichen Frieden, insbesondere die Eintracht der Bevölkerungsklassen gefährdenden Weise zu Tage treten.
Solche Überlegungen dürfen natürlich nicht zu Spitzfindigkeiten führen, mit denen die einfachste, die unmittelbarste Definition des Friedens beiseite geschoben würde, nämlich der Friede als Gegenteil des Kriegs. Ist doch die Bundesrepublik als Nachfolgestaat eines Deutschland entstanden, das den mörderischsten aller Kriege über die Welt brachte und das dann selbst durch den Krieg zerstört wurde.
Die Umwelt - insbesondere Frankreich - hat lange geglaubt, dies sei geschehen, weil die Deutschen, gewissermaßen als ethnische Gruppe, besonders kriegslustig, besonders kriegslüstern seien. Daß dem nie so war, das kann belegt und bewiesen werden.
Es bleibt aber mindestens, was der Bundespräsident in seiner großen Gedenkrede am 6. Mai dieses Jahres gesagt hat: »Hitler wollte den Krieg... Er verwandelte unser Land in eine riesige Kriegsmaschine, und jeder von uns war ein Rädchen darin. Das war erkennbar. Wir haben aber die Ohren und Augen geschlossen, hoffend, es möge anders sein.«
Weil es so war, und nicht bloß, um nie mehr solche Leiden erdulden zu müssen, haben die Männer und die Parteien, die die Bundesrepublik aufgebaut und gefestigt haben, dem Krieg abgeschworen und eine Politik des Gewaltverzichts betrieben.
Daß dabei auch Not zur Tugend gemacht wurde, ist klar. Ein zerstörtes, besetztes, entmündigtes Deutschland, wie hätte es denn Gewalt anwenden können? Dazu hatte es das Glück, keine Kolonien zu besitzen, also nicht in die Versuchung zu kommen, aussichtslose Kolonialkriege zu führen. Heute noch militärisch schwach und abhängig, wie könnte die Bundesrepublik an eine selbstmörderische Gewaltanwendung denken?
Eine solche, etwas zynische Feststellung darf nicht übersehen lassen, daß vieles auch hätte anders sein können. Die Vernunft verbot den Gedanken an die Gewalt.
Aber wer mag behaupten, daß Gewalt nur rational angewandt wird?
Nach dem Ersten Weltkrieg träumten etliche Deutsche von neuen Kämpfen. Nach dem Zweiten ist die Ablehnung alles Kriegerischen so stark geworden, daß das Prestige der Uniform trotz zwanzig Jahren Bundeswehr nie neu entstanden ist. Die Romantik war 1920 bei den Freikorps. Heute ist sie bei den Kriegsdienstverweigerern, und die Bundeswehr findet Offiziersanwärter durch Versprechen eines zukünftigen, guten Zivilberufs.
Es wäre unvernünftig gewesen, am 17. Juni 1953 an Gegengewalt zu denken. Es wäre unvernünftig gewesen, am 13. August 1961 zu versuchen, dem letzten Schritt zur gewaltsamen Zerreißung Deutschlands mit Gewalt entgegenzutreten. Die vernünftige, aber demütigende Zurückhaltung: als selbstverständlich sollte sie nicht betrachtet werden, besonders im Hinblick auf so viele emotionelle, unvernünftige Friedenszerstörungen, die es in der jüngsten Zeit gerade unter oder in schwachen, armen, besonders friedensbedürftigen Ländern gegeben hat.
Selbstverständlich war auch nicht die friedlichste der Entscheidungen, die von der ersten Bundesregierung getroffen wurde. Gewiß stand sowieso ein klarer Gewaltverzicht in der Charta der Heimatvertriebenen. Aber wie groß wäre die Versuchung des Friedensbruches nach Jahren und Jahrzehnten geworden, wenn die Bundesrepublik nicht die Eingliederung der Vertriebenen tatkräftig vollbracht, wenn sie so gehandelt hätte, wie jene Staaten, die absichtlich die Palästina-Flüchtlinge in ihren Lagern gelassen haben, obwohl diese auch der arabischen Nation angehörten?
Eingliederung und Aufrechterhaltung der territorialen Forderung schlössen einander auf die Dauer aus, so daß der Warschauer Vertrag von 1970 gewissermaßen die Endstufe der zwanzig Jahre davor begonnenen Politik darstellte. Die Zerstümmelung Deutschlands ist gewiß eine Konsequenz von Hitlers Krieg. Aber niemand im Ausland sollte den schmerzlichen Friedensbeitrag unterschätzen, den die Bundesrepublik geleistet hat!
Und den sie auch weiterhin leistet, indem sie nüchtern und zähe versucht, mit friedlichen Mitteln den Frieden in Europa etwas mehr mit jenen Prinzipien in Einklang zu bringen, zu denen die europäischen Regierungen jüngst in Helsinki Lippenbekenntnis abgelegt haben. Schritt für Schritt und unbeirrt versuchen, daß die langen Abschnitte über menschliche Kontakte, über Information, über Zusammenarbeit und Austausch im Bereich der Kultur eine tatsächliche Anwendung finden, insbesondere auf die Bürger des anderen deutschen Staats, auch wenn Grenzüberschreitung noch mit dem Leben bezahlt werden muß, auch wenn ein bundesdeutscher Gewerkschaftsführer von dort noch ausgewiesen wird, weil er sich unbewacht mit Arbeitern unterhalten hat: das ist ein echtes Verdienst, eine vernünftige Friedensarbeit!
Allzu stolz auf so viel Friedenswillen sollte man jedoch in der Bundesrepublik nicht sein, und zwar aus dreierlei Gründen. Zunächst, weil man es, um das Dokument von Helsinki zu zitieren, mit der »Verbreitung von Informationen aus den anderen Teilnehmerstaaten und eine bessere Kenntnis dieser Informationen« auch nicht gerade sehr genau genommen hat, insbesondere was das andere Deutschland anbelangt.
Sodann, weil den gebrachten, weitgehend auferlegten Opfern auch große Vorteile entsprochen haben. Der merkwürdige Frieden, den man Kalten Krieg nannte, hat die Teilung verankert. Er hat aber auch die Deutschen international wieder hoffähig gemacht, der Bundesrepublik den Weg zur Gleichberechtigung geebnet und vielen ihrer Bürger das angenehme Gefühl gegeben, von der Angeklagten-Rolle zur Ankläger-Rolle übergehen zu dürfen.
Schließlich und vor allem, weil ein allzu intensives Denken an die Ungerechtigkeit in Europa die Betrachtung anderer Ungerechtigkeiten vereitelt hat und noch vereitelt. Empörung und Selbstmitleid bringen manchen ein so gutes Gewissen, daß sie sich gar nicht die Frage stellen, ob sie nicht auch - durch Tun oder durch Unterlassen - woanders in der Welt empörende »Friedenssituationen« mitverschulden.
Ich weiß es wohl: Wenn man mir 1945 gesagt hätte, dreißig Jahre später würde ich den Deutschen vorwerfen, keine Weltpolitik haben zu wollen, so wäre mir das als ein Witz oder als eine Provokation vorgekommen.
Und doch: So gut die Einsicht auch sein mag, daß man keine Großmacht mehr ist, daß die Welt anders als am deutschen Wesen genesen soll, so unerfreulich wäre die Abdankung, die Flucht aus der Verantwortung, die für eine der größten Wirtschaftsmächte der Welt darin bestehen würde, einfach zu sagen: »Wir sind ja so klein! Laßt uns nur in Europa unseren Beitrag zum besseren Frieden leisten und ansonsten bereichernden Handel treiben. Amerika soll führen!«
Das gilt vor allem für die Weltwirtschaftspolitik. Gewiß, da gibt es eine wunderbare Entschuldigung für die Abstinenz. Während ein großer Teil der Welt den Gott Marx anbetet, gehört die Bundesrepublik zu den Anbetern eines anderen Gottes: des Gottes Markt!
Dieses oder jenes afrikanische Land geht heute beinahe daran zugrunde, daß der Preis des Kupfers zusammengebrochen ist. Was kann man da tun? Der Preis ist doch marktgerecht! Die erdölerzeugenden Staaten einigen sich, um einen gemeinsamen Verkaufspreis festzulegen: Welch marktverhöhnendes Kartell!
Das Schlimme ist, daß man in allen Parteien der Bundesrepublik so gläubig ist, daß man sich der Widersprüche gar nicht mehr recht bewußt wird. Und doch: Die Wirtschaft der Entwicklungsländer darf nicht durch feste Rohstoffpreisregelungen einigermaßen saniert werden, während man es nicht wagen würde, dem deutschen Bauernverband zu sagen, Preise dürfen nur vom Markt bestimmt werden. Und die Kartell-Verbindung unter den Öl-Ländern ist natürlich die erste, die es auf Rohstoffmärkten je gegeben hat!
Es wird bei all dem übersehen, daß die Weltfriedensordnung auf einem Begriff der freien Wirtschaft beruht, dessen Anwendung ständig die Reichen reicher und die Armen (das sind zwei Drittel der Menschheit) ärmer werden läßt.
Natürlich brächte eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung der Bundesrepublik, wie den anderen wohlhabenden Ländern, Probleme und Schwierigkeiten. Wenn man aber den echten Frieden erstrebt, so sollte man es nicht nur da tun, wo man selber eine Ungerechtigkeit zu ertragen hat.
*
Und nach innen? Wenn man an das Chaos von 1945 zurückdenkt oder auch mit den Weimarer Mißständen vergleicht, so ist das Erreichte geradezu verblüffend. Fast alle Wähler stimmen in freier Entscheidung für Parteien, die der Gewalt abgeschworen haben und eine pluralistisch-parlamentarische Friedensordnung bejahen. Der Begriff des Rechtsstaates beherrscht das öffentliche Leben, womit der Willkür der politischen Macht - Regierungen und Mehrheitsparteien in Bund und Ländern - enge Grenzen gesetzt werden, enger jedenfalls als in Frankreich, wenn auch in der Bundesrepublik neue Bedrohungen der pluralistischen Freiheit bestehen, insbesondere auf dem Gebiet des Funk- und Fernsehwesens, wo die politischen Mächte bald ebensowenig im Zaum gehalten sein werden wie bei uns in Frankreich.
Gerichte aller Art sorgen dafür, daß die Spielregeln, die Verfassung und Gesetz vorgeschrieben haben, eingehalten werden, wobei jeder, von der Regierung bis zum einzelnen Bürger, das Recht hat, nicht allein vor dem Richter zu stehen. Und wenn schon einmal Verteidiger sich allzusehr mit den Verteidigten identifizieren, so ist das viel weniger schlimm, als wenn die herrschende Rechtsordnung den Anwalt dazu zwingen würde, sich mit dem Staat und seiner Macht zu identifizieren, wie das bei den östlichen Nachbarn der Bundesrepublik der Fall ist.
Unsere Rechtsordnung im Westen (zu dem ich hier natürlich Spanien nicht rechne) beruht auf dem Prinzip, daß der Schuldige lieber zuviel Rechtsschutz erhalten soll, als der Unschuldige zu wenig. Man kann nur hoffen, daß die Bundesrepublik dieses Prinzip beibehalten wird.
Was mich etwas beunruhigt ist, daß in der letzten Zeit in der Bundesrepublik so viel vom Rechtsstaat und von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gesprochen wird. Vielleicht höre ich schlecht. Aber mir scheint, die Betonung liegt etwas zu sehr und immer mehr auf »Staat« und auf »Ordnung« und nicht mehr genug auf der Idee der freien politischen Tätigkeit des einzelnen, den gerade die Begriffe Staat und Ordnung nicht zum politischen autonomen Denken und Handeln auffordern.
Huldigen nicht manche Bürger der Bundesrepublik dem Staat mehr als dem Recht und erleben die freiheitlich-demokratische Grundordnung nur als eine Abwandlung der staatlichen Ordnung schlechthin, die ihren Vätern oder ihnen selbst, im Kaiserreich oder sogar im totalen Staat, den täglichen biederen Frieden sicherte?
Vielleicht bin ich zu sehr Franzose oder denke ich zu sehr an 1933, aber es scheint mir doch, als ob in der Bundesrepublik immer mehr von der Verteidigung der Grundordnung durch den Staat die Rede sei und immer weniger von der Verteidigung der Grundfreiheiten gegen den Staat.
Verständlich ist es: Wenn man endlich ein zugleich freiheitliches und geordnetes politisches System hat, so möchte man dessen Staatsstruktur erhalten. Aber muß deswegen der Begriff der Sicherheit einen solchen Platz einnehmen?
Der innere Friede soll gesichert werden. Wer bestreitet das? Es gibt Raub, Entführung, Mord! Die Polizei soll die Räuber, die Entführer, die Mörder finden und festnehmen. Die Richter sollen dann angemessene Strafen verhängen. Aber deswegen braucht doch noch nicht die gesamte Staatsordnung bedroht zu sein! Deswegen braucht man noch nicht zum Schutz der Freiheit Freiheiten beschränken!
Jahrelang ist die höchste Priorität der Außenpolitik der Bundesrepublik weder die Wiedervereinigung noch die europäische Einigung, sondern die Sicherheit gewesen. Heute, wo die Zielsetzung nach außen ausgeglichener ist, scheint plötzlich die Sicherheit die Priorität in der Innenpolitik einnehmen zu wollen.
Die Konsequenzen sind jedoch in einem wesentlichen Punkt nicht dieselben. Vorn potentiellen Feind von außen ist man abgesondert. Man gehört nicht derselben Gemeinschaft an wie er, was aus Sicherheitsmaßnahmen nicht einen Abruch mit ihm bedeuten läßt und alle möglichen Beziehungen mit diesem potentiellen Feind nicht ausschließt.
Der Feind von innen (oder der »innere Feind«, um den von Wilhelm II. so gern gebrauchten Ausdruck zu verwenden) muß erst abgesondert werden, was einen Ausschluß aus der Gemeinschaft oder wenigstens eine Isolierung innerhalb der Gemeinschaft bedeutet.
Sich irren in der Definition des Feindes von außen mag unerfreuliche Resultate zeitigen, nicht aber die selbstverstümmelnde Konsequenz des Irrtums in der Definition des inneren Feindes haben. Man soll die harte Weisung des Evangeliums nicht zu wörtlich nehmen. Bevor man das Glied abschneidet, das den Skandal hervorgerufen hat, darf man sich fragen, ob es nicht durch einen intimeren Kontakt mit dem gesunden Teil des Körpers geheilt werden könnte, oder auch, ob der Skandal nicht mitunter ein Zeichen der Lebendigkeit eines ansonsten etwas erstarrten Körpers sein mag.
Es ist noch Zeit zum Bedenken, denn so stark scheint die bundesdeutsche Friedensordnung noch nicht untergraben zu sein! Man lese nur den in diesem Frühjahr veröffentlichten Verfassungsschutzbericht 1974. Darin steht, daß die Terrorgruppen »selbst unter den übrigen Linksextremisten weitgehend isoliert« sind. Und »der übrige Linksextremismus bedeutet gegenwärtig keine konkrete Gefahr für den Bestand unserer freiheitlichdemokratischen Grundordnung und die innere Sicherheit unseres Landes«.
Nun heißt es, aus der Gemeinschaft wird ja niemand ausgestoßen, sondern nur aus dem öffentlichen Dienst.
Da tauchen zwei Fragen auf: Wie groß ist hier die Bedrohung und was ist öffentlicher Dienst? Der Verfassungsschutzbericht gibt eine doppelte Antwort:
Ende 1974 waren - soweit bekannt - insgesamt 1467 Linksextremisten im öffentlichen Dienst beschäftigt. Bei insgesamt 3,4 Millionen öffentlichen Bediensteten entfällt auf je 2302 Angehörige des öffentlichen Dienstes ein linksextremistischer Bediensteter. Von den 258 linksextremistischen Bundesbediensteten sind rund 78 Prozent (203) bei Bundespost und Bundesbahn in nachgeordneten Positionen tätig. Die Gefahr für den Staat scheint also nicht angsterregend. Aber eine andere Gefahr ist klar: Wenn nicht nur der Ministerialbeamte mit Autorität, sondern bereits der Briefträger und der Stationsvorsteher Elemente der staatlichen Friedensordnung sind, so befindet man sich auf dem Weg, der im anderen deutschen Staat voll zurückgelegt worden ist: Da ja die ganze Gesellschaft zur kollektiven Staatsordnung gehört, ist es unerträglich, daß irgendeiner, vom Lehrer bis zum Arzt, vom Bahnbeamten bis zum Metallarbeiter, mehr als unwesentliche Kritik ausübt.
Wenn jemand gegen das Gesetz verstoßen hat, soll er bestraft werden. Wenn ein Beamter seine Dienstpflicht verletzt hat, soll er gemaßregelt werden. Aber ich kann nur schwer verstehen, was eine zukunftsbezogene Beurteilung, eine zukunftsbezogene Verurteilung ist. Der Gedanke, es soll eine Gesinnungsprüfung mit abschließender »Prognose« über das zukünftige Benehmen des Geprüften geben, scheint mir, ich muß es sagen, in doppelter Hinsicht etwas absonderlich.
Zunächst wegen der Vergangenheit. Wenn ich recht verstehe, sollen junge Leute vorsorglich ausgeschlossen bleiben, weil sie ihre Weltanschauung nicht mehr ändern und möglicherweise ihre Pflicht dem Rechtsstaat gegenüber verletzen werden, wohingegen es sich die Bundesrepublik leisten konnte, Männern wichtige staatliche Positionen anzuvertrauen, die als Verteidiger des Rechtsstaates völlig versagt hatten.
Wenn man die Nürnberger Judengesetze als normales Recht trocken ausgelegt hatte, durfte man Staatssekretär im neuen Rechtsstaat werden. Wenn man die Gestapo polizeirechtlich gerechtfertigt hatte, durfte man in der freiheitlichen Grundordnung Rektor und Kultusminister werden. Die Kriterien, die nun verbieten sollen, Zollbeamter oder Dorfschullehrer zu werden, scheinen mir wahrlich strenger zu sein.
Warum ist dem so? Weil die nach 1945 Hochgekommenen trotz ihrer Vergangenheit mit Sicherheit diese freiheitlich-demokratische Grundordnung im Notfall nun verteidigen würden? Niemand kann garantieren, daß der junge Mann, der heute an Systemveränderung glaubt, in einigen Jahren wirklich die Grundrechte und die pluralistische Freiheit gegen einen revolutionären Umsturz verteidigen wird.
Aber wer garantiert denn, daß Aberhunderte von Beamten des heutigen Staates die Grundfreiheiten des Bürgers gegen die Staatsmacht verteidigen würden, wenn sich, durch diese oder jene wirtschaftliche Entwicklung gefördert, ein neues autoritäres Regime anbahnen würde?
Die größte Gefahr, die eine Demokratie von innen bedrohen kann, das sind nicht so sehr die ihr feindlich gesonnenen kleinen Gruppen. Das ist das Mitläufertum.
Dies sieht man ja seit einigen Jahren an den deutschen Universitäten. Wenn ein paar Revolutionäre, deren sture und brutale Intoleranz weitgehend die entgegengesetzte Intoleranz gezeitigt hat, den Frieden eines Hörsaals gewaltsam stören und zerstören können, so darum, weil sich die Hunderte von anwesenden Studenten so passiv benehmen wie ihre Vorgänger 1933.
Aber wenn jeder Anwärter auf eine Stellung im öffentlichen Dienst auf Herz und Nieren geprüft werden soll, wenn er Fragebogen (ja, Fragebogen!) auszufüllen hat, wenn dem Gymnasiasten schon klar wird, was er zu unterlassen und was er brav zu sagen hat, um später keine Schwierigkeiten zu bekommen, so vermeidet man weniger Gefahren für die Grundordnung, als wenn man junge Generationen zum Konformismus und zu einem gefährlichen Mitläufertum verleitet.
Dabei ist doch die Gefahr von innen mit der Gefahr von außen gar nicht so sehr verknüpft. Bei einem Jugendlichen, der mit ketzerischen Ideen herumläuft, sind die Chancen, daß er ein Agent sei, geringer als bei einem biederen Ostflüchtling, der durch Verheimlichung seinen Weg bis hoch nach oben machen kann. Und daß dieser Jugendliche ein unbewußter Agent sei, das erinnert wirklich allzusehr an den im Osten für alle Abweichenden gebrauchten Begriff des »objektiven« Verrats.
Agenten: wenige. Rebellen: viel mehr. Aber Rebellen wogegen? Wenn es gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, muß die Rebellion mit Entschiedenheit abgelehnt werden. Was ist nun aber diese Grundordnung?
Hier herrscht eine erstaunliche Konfusion. Man tut, als sei die politische Ordnung mit der Gesellschaftsordnung identisch. In der Urteilsbegründung des Bundesverfassungsgerichts über die Zulassung zum öffentlichen Dienst wird von denen gesprochen, die - ich zitiere - »die rechts- und sozialstaatliche Ordnung ablehnen«. Soll das etwa heißen, daß die gesellschaftliche Ordnung in der Bundesrepublik als ebenso vorbildlich und erhaltungswürdig dargestellt wird wie der politische Pluralismus und die Grundrechte?
Wenn ja, so birgt dies eine echte Gefahr: Daß immer mehr anspruchsvolle Jugendliche glauben, man könne das Ungerechte an dieser Gesellschaftsordnung nicht verändern, ohne zugleich die rechtsstaatliche Ordnung zu beseitigen!
Glücklicherweise wird auch eine andere Sprache gesprochen. Ich möchte hier den schönen Artikel zitieren, den der Vorsitzende und Kanzlerkandidat der großen Oppositionspartei zum jüngsten Evangelischen Kirchentag geschrieben hat:
Allen voran unseren Begriff von Freiheit, der nie nur die eigene Freiheit meint, sondern immer auch die Freiheit des anderen, des nächsten einschließt. Dieses Verständnis von Freiheit schließt auch die Pflicht ein, meinem Nachbarn seine Freiheit zu lassen, ja, sie ihm aktiv zu verschaffen und dazu entsprechend dem Gebot der sozialen Gerechtigkeit notfalls jene gesellschaftlichen Hindernisse hinwegzuräumen, die seiner freien Selbstentfaltung im Wege stehen. Die soziale Gerechtigkeit ist ein Ziel, kein Zustand, keine durch die Grundgesetzformulierungen bereits geschaffene Wirklichkeit. Tun wir nicht so wie Bismarck, der in dem zitierten Sozialistengesetz Staats- und Gesellschaftsordnung auf einen Nenner brachte. Vor allem, da ja das Grundgesetz die Veränderung und sogar die Verwandlung zuläßt und vorsieht.
Ist man z. B. schon »auch so einer«, wenn man, über die Spekulation empört, das Eigentumsrecht nicht an die Spitze aller Werte stellt und wegen dem für Häuserbau geeigneten Boden an den Artikel 15 des Grundgesetzes denkt?
Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können ... in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Untergräbt man die Grundfreiheiten, wenn man nach Regulierungen sucht, die endlich den Respekt für die Würde der Person den Alten, den Kranken, den Wirtschaftsschwachen in der Tat zugestehen würde? Oder wenn man sich daran stößt, daß der Gewinn privat bleiben und der Verlust dank Zuschuß der öffentlichen Hand sozialisiert werden soll? Oder daran, daß der Finanzverbrecher mit Krawatte weniger bestraft werden mag als der Motorraddieb mit langen Haaren? Oder daß ein Vorstandsmitglied, bei schlechter Arbeit für 30000 oder 50000 DM pro Monat höchstens riskiert, mit einer hohen Abfindung bequem weiterleben zu können, während der einwandfrei arbeitende Angestellte oder Arbeiter, der durch dieses »Mißmanagement« seine Stelle verliert, zwar besser daran ist als seine Vorfahren, aber doch um das tagtägliche Schicksal der Seinen bangen muß?
Ja, bangen! Was mich besorgt für den inneren Frieden der Bundesrepublik, das sind die Auswirkungen der neuen Angst. Ich meine hier nicht die Angst vor der umstürzlerischen Bedrohung. Auch nicht so sehr die bei manchem entstehende Angst, sie könnten die Forderungen der inquisitorischen Verteidiger der Grundordnung nicht genügend erfüllen. Sondern die einfache Angst vor der Zukunft, die durch Wirtschaftunsicherheit und Arbeitslosigkeit entsteht.
Bis jetzt gibt es noch keine Anzeichen dafür, daß sich die Bürger in Angst von den demokratischen Parteien abwenden. Aber das ist kein genügender Grund, um unbesorgt zu sein.
*
In Sorgen- und Krisenzeit: Was heißt es denn, dem inneren Frieden dienen? Zunächst, keine falschen Hoffnungen erwecken. Eine Demokratie ist erst dann mündig, wenn die Männer, denen die Macht anvertraut wurde, und diejenigen, die legitim ihren Platz einnehmen wollen, fähig sind, bittere Wahrheiten zu sagen, und wenn die Regierten bereit sind, diese Wahrheiten zu hören. Was eine mündige Demokratie ist, das hat Großbritannien 1940-41 gezeigt.
Sodann: Nicht versuchen, die allgemeine Sorge durch Ablenkung aus dem Weg zu räumen. Ablenkung auf Sündenböcke, die am Rande des politischen Spiels stehen. Ablenkung durch Verteufelung des Gegners im normalen Kampf um die Macht.
Das freie Wort und die freie Schrift dienen dem Frieden nicht, wenn sie im Parlament zur gegenseitigen Beschimpfung, in der Presse zu ständiger Verdächtigung von Männern und von Parteien führen.
Das ist um so schlimmer, als es darum gehen sollte, echte Spannungen und Gegensätze in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft klar darzulegen und auszutragen. Nicht, daß es in der Gesellschaft nur Konflikte gäbe, wie es bei der extremen Linken gesagt und sogar manchmal in Richtlinien für Erzieher niedergeschrieben wird. Aber es ist ebensowenig angebracht, so zu tun, als gäbe es nur Sozialpartner, die ungefähr so zusammenhalten sollten wie Partner, die gemeinsam und ebenbürtig ein Unternehmen besitzen.
Gerade in Krisenzeiten ist es für die Schwachen besonders gefährlich, daß Interessengegensätze vertuscht werden. Gegensätze, die nicht selten im dunkeln bleiben, wenn sie »die da unten« und »die da oben« gegenüberstellen, wobei »die da oben« nicht nur die Mächtigen der Geld- und Privatwirtschaft, sondern auch die Träger der Staats- oder Gewerkschaftsmacht sein können.
Denn besonders von den Schwachen wird in Krisenzeiten verlangt, daß sie sich friedlich verhalten, daß sie sich zufriedengeben. Den inneren gerechten Frieden anstreben, das heißt, gerade in schwieriger Wirtschaftslage die Schwäche der Schwachen nicht ausnutzen, sei es nur, indem man das sogenannte freie Spiel der Kräfte walten läßt.
*
Bei all dem bleibt unbestritten, daß die Bundesrepublik für den inneren wie den äußeren freiheitlichen und gleichheitlichen Frieden viel geleistet hat, auch und vor allem im internationalen Vergleich.
In der Umwelt muß das Geleistete immer wieder hervorgehoben werden, um noch bestehende Vorurteile - antideutsche Vorurteile und sozialphilosophische Vorurteile - zu beseitigen. Das versuche ich auch stets zu tun, wenn ich in Frankreich oder in anderen Ländern spreche.
Innerhalb der Bundesrepublik hingegen sollte man eher kritisch fordernd hervorheben, was noch nicht erreicht ist oder was sich von dem bereits Erreichten wieder entfernt. Hat die Bundesrepublik doch das tragische Glück, durch den notwendigen Gegensatz zum unmenschlichen Hitler-Regime gezwungen worden zu sein, ihr politisches System auf einer Ethik aufzubauen.
Es ist kein Zufall, daß eine der beiden großen Parteien als »geistige und sittliche Wurzeln des sozialistischen Gedankenguts« »Christentum, Humanismus und klassische Philosophie« nennt, während die andere ein C in ihrem Namen führt, das auf Nächstenliebe und nicht auf Scheiterhaufen hinweisen soll.
Kritisch fordernd wollte ich also auch heute sein. Ob nun der Friedenspreisträger friedsam gesprochen hat, das bleibe dahingestellt. Daß er es lediglich friedensfordernd gemeint hat, das darf er seinen geduldigen Hörern zum Abschluß versichern.
Dankbarkeit und Freude: daß ich beide Gefühle hier und heute empfinde, wird niemanden überraschen. So brauche ich nur kurz zu sagen, wie sehr ich allen danke.
Denen, die mich auserkoren haben. Dem, der die Pflichtübung des Lobes mit einer fruchtbaren kritischen Analyse im Sinne unserer langjährigen gemeinsamen Bestrebungen verbunden hat, und dem ich überhaupt für die Freundschaft dankbar bin, die nun seit einem Vierteljahrhundert besteht. Denen schließlich, die mir die Ehre erweisen, heute hier anwesend zu sein.
Wer und was ist nun soeben »preisgekrönt« worden? Es muß betont werden, daß ich als Stellvertreter dastehe. Stellvertretend für all jene Franzosen, die nach 1945 Deutschland und den Deutschen gegenüber die warme und tatkräftige Vernunft haben walten lassen und somit ihre Landsleute positiv beeinflußt haben. Für die unter ihnen, die sich durch Wort und Schrift eingesetzt haben, und noch mehr für die Unbekannten, die eine mühselige, zeit- und vor allem freizeitraubende Kleinarbeit vollbracht haben und noch vollbringen.
Aber nicht nur als Stellvertreter. Ich darf annehmen, daß durch die Preisverleihung ein besonderer Aspekt der Mittlerfunktion, die ich versuche auszuüben, besonders gutgeheißen wird. Nämlich mein ständiger Versuch, meine ständige Versuchung, auf die Entwicklung der Bundesrepublik etwas Einfluß auszuüben, indem ich die deutschen Verhältnisse für deutsche Leser und Hörer so darstelle, wie ich sie als wohlwollend besorgter Außenstehender sehe.
Ich betrachte den Preis als eine Ermutigung, mich auch weiterhin in der Bundesrepublik dem Vorwurf auszusetzen, ich mische mich in fremde Angelegenheiten ein. Was heißt da übrigens fremd? Es war doch gerade weil wir uns für die deutsche Zukunft mitverantwortlich fühlten, daß wir die Zusammenarbeit begannen und die gegenseitige Beeinflussung guthießen.
So darf ich annehmen, daß von mir keine schöngeistige Rede, keine tiefe philosophische Betrachtung über die Natur des Friedens erwartet wird, sondern Gedanken, die der Haltung entsprechen, für die man mir die Ehrung hat widerfahren lassen.
Das Thema liegt somit auf der Hand. Was bedeutet der Frieden für die Bundesrepublik? Der Frieden in der weiten Welt und der Frieden innerhalb ihrer Grenzen.
Ein paar Worte sind nun doch notwendig, um den Standpunkt zu verdeutlichen, von dem aus die bundesdeutsche Entwicklung beleuchtet werden soll.
Den Frieden schlechthin gibt es nicht, genausowenig wie es die Wahrheit schlechthin gibt oder die Objektivität. Kein Journalist, kein Sozialwissenschaftler ist objektiv. Aber es besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen denen, die selbstkritisch und selbsterzieherisch nach der Objektivität streben, und denen, die dies nicht tun. Gerade die, die wissen, wie unvollständig ihre eigene Objektivität ist, sind dadurch fähig, die Dinge unvoreingenommener zu betrachten und zu beschreiben als diejenigen, die wähnen, objektiv zu sein.
Es gibt keine absolute Wahrheit. Es gibt aber Dinge, die wahrer sind als andere. Und gerade die, die empfinden, daß sie nur Teilwahrheiten erreicht haben, wissen, daß die anderen, daß auch die Gegner einen Teil der Wahrheit vertreten und sind deshalb einer vollständigeren Wahrheit näher als jene, die wähnen, die Wahrheit zu besitzen, was sie beinahe notwendigerweise zur Beschränktheit und zur Intoleranz verleitet.
Es gibt keinen totalen Frieden, aber es gibt Strukturen und Verhalten, die friedensfördernder sind als andere. Situationen, die einem Frieden der Gerechtigkeit näher kommen als andere. Gerade die, die wissen, daß der bestehende Friede teilweise ein aufgezwungenes Sichzufriedengeben der Schwachen, der Benachteiligten beträgt, erkennen, daß neue Schritte zu einem besseren Frieden unternommen werden sollten. Diejenigen dagegen, die wähnen, in einem schönen Frieden zu leben, sind nur allzuoft Pharisäer, die nicht sehen, inwiefern dieser Frieden für andere das Festfrieren, das Erstarren einer Ungerechtigkeit bedeutet.
Keine Gesellschaftsordnung ist so vollkommen, daß sie nicht von einem Teil der Menschen, die ihr angehören, zu Recht als eine Unordnung betrachtet werden könnte. Kein internationaler oder innerer Frieden ist so vollkommen, daß die Abwesenheit der blutvergießenden Gewalt nicht teilweise einer Resignation zuzuschreiben wäre, nämlich der Resignation derer, die an den Mitteln verzweifeln, die ihnen in der Friedensordnung zur Verfügung stehen, um ihr schlimmes Schicksal zu verändern.
1953 wurde der Frieden in Ostberlin gebrochen, 1956 in Budapest. Heute herrscht wieder Friede in der DDR und in Ungarn. Mit wieviel Resignation? Vor zehn Jahren gab es Brand und Blutvergießen im schwarzen Stadtteil Watts von Los Angeles. Heute herrscht dort Friede. Vermindert wurden Elend und Ungerechtigkeit nicht.
Bei einer Ost-West-Begegnung in Leningrad beklagte ich, daß der Prager Frühling 1968 direkt in einen dauerhaften Winter verwandelt worden sei. Darauf wurde mir entgegnet: »Das Bild stimmt nicht. Es sollte heißen: im Frühling kann geschehen, daß Flüsse über ihr Bett hinaustreten. Dabei werden sie schmutzig. Wir werden von jetzt ab dafür sorgen, daß sie sauber bleiben!«
Sauber wie alle Friedensordnungen, die auferlegt werden, indem man die »Störenfriede« ausschaltet. Sauber z. B. wie die Gesellschaftsstrukturen, die Bismarck als innere Friedensordnung bewahren wollte, als er 1878 das »Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie« schuf, dessen erster Artikel folgendermaßen lautete:
Vereine, welche durch sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische Bestrebungen den Umsturz der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung bezwecken, sind zu verbieten.
Dasselbe gilt von Vereinen, in welchen sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische, auf den Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen in einer den öffentlichen Frieden, insbesondere die Eintracht der Bevölkerungsklassen gefährdenden Weise zu Tage treten.
Solche Überlegungen dürfen natürlich nicht zu Spitzfindigkeiten führen, mit denen die einfachste, die unmittelbarste Definition des Friedens beiseite geschoben würde, nämlich der Friede als Gegenteil des Kriegs. Ist doch die Bundesrepublik als Nachfolgestaat eines Deutschland entstanden, das den mörderischsten aller Kriege über die Welt brachte und das dann selbst durch den Krieg zerstört wurde.
Die Umwelt - insbesondere Frankreich - hat lange geglaubt, dies sei geschehen, weil die Deutschen, gewissermaßen als ethnische Gruppe, besonders kriegslustig, besonders kriegslüstern seien. Daß dem nie so war, das kann belegt und bewiesen werden.
Es bleibt aber mindestens, was der Bundespräsident in seiner großen Gedenkrede am 6. Mai dieses Jahres gesagt hat: »Hitler wollte den Krieg... Er verwandelte unser Land in eine riesige Kriegsmaschine, und jeder von uns war ein Rädchen darin. Das war erkennbar. Wir haben aber die Ohren und Augen geschlossen, hoffend, es möge anders sein.«
Weil es so war, und nicht bloß, um nie mehr solche Leiden erdulden zu müssen, haben die Männer und die Parteien, die die Bundesrepublik aufgebaut und gefestigt haben, dem Krieg abgeschworen und eine Politik des Gewaltverzichts betrieben.
Daß dabei auch Not zur Tugend gemacht wurde, ist klar. Ein zerstörtes, besetztes, entmündigtes Deutschland, wie hätte es denn Gewalt anwenden können? Dazu hatte es das Glück, keine Kolonien zu besitzen, also nicht in die Versuchung zu kommen, aussichtslose Kolonialkriege zu führen. Heute noch militärisch schwach und abhängig, wie könnte die Bundesrepublik an eine selbstmörderische Gewaltanwendung denken?
Eine solche, etwas zynische Feststellung darf nicht übersehen lassen, daß vieles auch hätte anders sein können. Die Vernunft verbot den Gedanken an die Gewalt.
Aber wer mag behaupten, daß Gewalt nur rational angewandt wird?
Nach dem Ersten Weltkrieg träumten etliche Deutsche von neuen Kämpfen. Nach dem Zweiten ist die Ablehnung alles Kriegerischen so stark geworden, daß das Prestige der Uniform trotz zwanzig Jahren Bundeswehr nie neu entstanden ist. Die Romantik war 1920 bei den Freikorps. Heute ist sie bei den Kriegsdienstverweigerern, und die Bundeswehr findet Offiziersanwärter durch Versprechen eines zukünftigen, guten Zivilberufs.
Es wäre unvernünftig gewesen, am 17. Juni 1953 an Gegengewalt zu denken. Es wäre unvernünftig gewesen, am 13. August 1961 zu versuchen, dem letzten Schritt zur gewaltsamen Zerreißung Deutschlands mit Gewalt entgegenzutreten. Die vernünftige, aber demütigende Zurückhaltung: als selbstverständlich sollte sie nicht betrachtet werden, besonders im Hinblick auf so viele emotionelle, unvernünftige Friedenszerstörungen, die es in der jüngsten Zeit gerade unter oder in schwachen, armen, besonders friedensbedürftigen Ländern gegeben hat.
Selbstverständlich war auch nicht die friedlichste der Entscheidungen, die von der ersten Bundesregierung getroffen wurde. Gewiß stand sowieso ein klarer Gewaltverzicht in der Charta der Heimatvertriebenen. Aber wie groß wäre die Versuchung des Friedensbruches nach Jahren und Jahrzehnten geworden, wenn die Bundesrepublik nicht die Eingliederung der Vertriebenen tatkräftig vollbracht, wenn sie so gehandelt hätte, wie jene Staaten, die absichtlich die Palästina-Flüchtlinge in ihren Lagern gelassen haben, obwohl diese auch der arabischen Nation angehörten?
Eingliederung und Aufrechterhaltung der territorialen Forderung schlössen einander auf die Dauer aus, so daß der Warschauer Vertrag von 1970 gewissermaßen die Endstufe der zwanzig Jahre davor begonnenen Politik darstellte. Die Zerstümmelung Deutschlands ist gewiß eine Konsequenz von Hitlers Krieg. Aber niemand im Ausland sollte den schmerzlichen Friedensbeitrag unterschätzen, den die Bundesrepublik geleistet hat!
Und den sie auch weiterhin leistet, indem sie nüchtern und zähe versucht, mit friedlichen Mitteln den Frieden in Europa etwas mehr mit jenen Prinzipien in Einklang zu bringen, zu denen die europäischen Regierungen jüngst in Helsinki Lippenbekenntnis abgelegt haben. Schritt für Schritt und unbeirrt versuchen, daß die langen Abschnitte über menschliche Kontakte, über Information, über Zusammenarbeit und Austausch im Bereich der Kultur eine tatsächliche Anwendung finden, insbesondere auf die Bürger des anderen deutschen Staats, auch wenn Grenzüberschreitung noch mit dem Leben bezahlt werden muß, auch wenn ein bundesdeutscher Gewerkschaftsführer von dort noch ausgewiesen wird, weil er sich unbewacht mit Arbeitern unterhalten hat: das ist ein echtes Verdienst, eine vernünftige Friedensarbeit!
Allzu stolz auf so viel Friedenswillen sollte man jedoch in der Bundesrepublik nicht sein, und zwar aus dreierlei Gründen. Zunächst, weil man es, um das Dokument von Helsinki zu zitieren, mit der »Verbreitung von Informationen aus den anderen Teilnehmerstaaten und eine bessere Kenntnis dieser Informationen« auch nicht gerade sehr genau genommen hat, insbesondere was das andere Deutschland anbelangt.
Sodann, weil den gebrachten, weitgehend auferlegten Opfern auch große Vorteile entsprochen haben. Der merkwürdige Frieden, den man Kalten Krieg nannte, hat die Teilung verankert. Er hat aber auch die Deutschen international wieder hoffähig gemacht, der Bundesrepublik den Weg zur Gleichberechtigung geebnet und vielen ihrer Bürger das angenehme Gefühl gegeben, von der Angeklagten-Rolle zur Ankläger-Rolle übergehen zu dürfen.
Schließlich und vor allem, weil ein allzu intensives Denken an die Ungerechtigkeit in Europa die Betrachtung anderer Ungerechtigkeiten vereitelt hat und noch vereitelt. Empörung und Selbstmitleid bringen manchen ein so gutes Gewissen, daß sie sich gar nicht die Frage stellen, ob sie nicht auch - durch Tun oder durch Unterlassen - woanders in der Welt empörende »Friedenssituationen« mitverschulden.
Ich weiß es wohl: Wenn man mir 1945 gesagt hätte, dreißig Jahre später würde ich den Deutschen vorwerfen, keine Weltpolitik haben zu wollen, so wäre mir das als ein Witz oder als eine Provokation vorgekommen.
Und doch: So gut die Einsicht auch sein mag, daß man keine Großmacht mehr ist, daß die Welt anders als am deutschen Wesen genesen soll, so unerfreulich wäre die Abdankung, die Flucht aus der Verantwortung, die für eine der größten Wirtschaftsmächte der Welt darin bestehen würde, einfach zu sagen: »Wir sind ja so klein! Laßt uns nur in Europa unseren Beitrag zum besseren Frieden leisten und ansonsten bereichernden Handel treiben. Amerika soll führen!«
Das gilt vor allem für die Weltwirtschaftspolitik. Gewiß, da gibt es eine wunderbare Entschuldigung für die Abstinenz. Während ein großer Teil der Welt den Gott Marx anbetet, gehört die Bundesrepublik zu den Anbetern eines anderen Gottes: des Gottes Markt!
Dieses oder jenes afrikanische Land geht heute beinahe daran zugrunde, daß der Preis des Kupfers zusammengebrochen ist. Was kann man da tun? Der Preis ist doch marktgerecht! Die erdölerzeugenden Staaten einigen sich, um einen gemeinsamen Verkaufspreis festzulegen: Welch marktverhöhnendes Kartell!
Das Schlimme ist, daß man in allen Parteien der Bundesrepublik so gläubig ist, daß man sich der Widersprüche gar nicht mehr recht bewußt wird. Und doch: Die Wirtschaft der Entwicklungsländer darf nicht durch feste Rohstoffpreisregelungen einigermaßen saniert werden, während man es nicht wagen würde, dem deutschen Bauernverband zu sagen, Preise dürfen nur vom Markt bestimmt werden. Und die Kartell-Verbindung unter den Öl-Ländern ist natürlich die erste, die es auf Rohstoffmärkten je gegeben hat!
Es wird bei all dem übersehen, daß die Weltfriedensordnung auf einem Begriff der freien Wirtschaft beruht, dessen Anwendung ständig die Reichen reicher und die Armen (das sind zwei Drittel der Menschheit) ärmer werden läßt.
Natürlich brächte eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung der Bundesrepublik, wie den anderen wohlhabenden Ländern, Probleme und Schwierigkeiten. Wenn man aber den echten Frieden erstrebt, so sollte man es nicht nur da tun, wo man selber eine Ungerechtigkeit zu ertragen hat.
*
Und nach innen? Wenn man an das Chaos von 1945 zurückdenkt oder auch mit den Weimarer Mißständen vergleicht, so ist das Erreichte geradezu verblüffend. Fast alle Wähler stimmen in freier Entscheidung für Parteien, die der Gewalt abgeschworen haben und eine pluralistisch-parlamentarische Friedensordnung bejahen. Der Begriff des Rechtsstaates beherrscht das öffentliche Leben, womit der Willkür der politischen Macht - Regierungen und Mehrheitsparteien in Bund und Ländern - enge Grenzen gesetzt werden, enger jedenfalls als in Frankreich, wenn auch in der Bundesrepublik neue Bedrohungen der pluralistischen Freiheit bestehen, insbesondere auf dem Gebiet des Funk- und Fernsehwesens, wo die politischen Mächte bald ebensowenig im Zaum gehalten sein werden wie bei uns in Frankreich.
Gerichte aller Art sorgen dafür, daß die Spielregeln, die Verfassung und Gesetz vorgeschrieben haben, eingehalten werden, wobei jeder, von der Regierung bis zum einzelnen Bürger, das Recht hat, nicht allein vor dem Richter zu stehen. Und wenn schon einmal Verteidiger sich allzusehr mit den Verteidigten identifizieren, so ist das viel weniger schlimm, als wenn die herrschende Rechtsordnung den Anwalt dazu zwingen würde, sich mit dem Staat und seiner Macht zu identifizieren, wie das bei den östlichen Nachbarn der Bundesrepublik der Fall ist.
Unsere Rechtsordnung im Westen (zu dem ich hier natürlich Spanien nicht rechne) beruht auf dem Prinzip, daß der Schuldige lieber zuviel Rechtsschutz erhalten soll, als der Unschuldige zu wenig. Man kann nur hoffen, daß die Bundesrepublik dieses Prinzip beibehalten wird.
Was mich etwas beunruhigt ist, daß in der letzten Zeit in der Bundesrepublik so viel vom Rechtsstaat und von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gesprochen wird. Vielleicht höre ich schlecht. Aber mir scheint, die Betonung liegt etwas zu sehr und immer mehr auf »Staat« und auf »Ordnung« und nicht mehr genug auf der Idee der freien politischen Tätigkeit des einzelnen, den gerade die Begriffe Staat und Ordnung nicht zum politischen autonomen Denken und Handeln auffordern.
Huldigen nicht manche Bürger der Bundesrepublik dem Staat mehr als dem Recht und erleben die freiheitlich-demokratische Grundordnung nur als eine Abwandlung der staatlichen Ordnung schlechthin, die ihren Vätern oder ihnen selbst, im Kaiserreich oder sogar im totalen Staat, den täglichen biederen Frieden sicherte?
Vielleicht bin ich zu sehr Franzose oder denke ich zu sehr an 1933, aber es scheint mir doch, als ob in der Bundesrepublik immer mehr von der Verteidigung der Grundordnung durch den Staat die Rede sei und immer weniger von der Verteidigung der Grundfreiheiten gegen den Staat.
Verständlich ist es: Wenn man endlich ein zugleich freiheitliches und geordnetes politisches System hat, so möchte man dessen Staatsstruktur erhalten. Aber muß deswegen der Begriff der Sicherheit einen solchen Platz einnehmen?
Der innere Friede soll gesichert werden. Wer bestreitet das? Es gibt Raub, Entführung, Mord! Die Polizei soll die Räuber, die Entführer, die Mörder finden und festnehmen. Die Richter sollen dann angemessene Strafen verhängen. Aber deswegen braucht doch noch nicht die gesamte Staatsordnung bedroht zu sein! Deswegen braucht man noch nicht zum Schutz der Freiheit Freiheiten beschränken!
Jahrelang ist die höchste Priorität der Außenpolitik der Bundesrepublik weder die Wiedervereinigung noch die europäische Einigung, sondern die Sicherheit gewesen. Heute, wo die Zielsetzung nach außen ausgeglichener ist, scheint plötzlich die Sicherheit die Priorität in der Innenpolitik einnehmen zu wollen.
Die Konsequenzen sind jedoch in einem wesentlichen Punkt nicht dieselben. Vorn potentiellen Feind von außen ist man abgesondert. Man gehört nicht derselben Gemeinschaft an wie er, was aus Sicherheitsmaßnahmen nicht einen Abruch mit ihm bedeuten läßt und alle möglichen Beziehungen mit diesem potentiellen Feind nicht ausschließt.
Der Feind von innen (oder der »innere Feind«, um den von Wilhelm II. so gern gebrauchten Ausdruck zu verwenden) muß erst abgesondert werden, was einen Ausschluß aus der Gemeinschaft oder wenigstens eine Isolierung innerhalb der Gemeinschaft bedeutet.
Sich irren in der Definition des Feindes von außen mag unerfreuliche Resultate zeitigen, nicht aber die selbstverstümmelnde Konsequenz des Irrtums in der Definition des inneren Feindes haben. Man soll die harte Weisung des Evangeliums nicht zu wörtlich nehmen. Bevor man das Glied abschneidet, das den Skandal hervorgerufen hat, darf man sich fragen, ob es nicht durch einen intimeren Kontakt mit dem gesunden Teil des Körpers geheilt werden könnte, oder auch, ob der Skandal nicht mitunter ein Zeichen der Lebendigkeit eines ansonsten etwas erstarrten Körpers sein mag.
Es ist noch Zeit zum Bedenken, denn so stark scheint die bundesdeutsche Friedensordnung noch nicht untergraben zu sein! Man lese nur den in diesem Frühjahr veröffentlichten Verfassungsschutzbericht 1974. Darin steht, daß die Terrorgruppen »selbst unter den übrigen Linksextremisten weitgehend isoliert« sind. Und »der übrige Linksextremismus bedeutet gegenwärtig keine konkrete Gefahr für den Bestand unserer freiheitlichdemokratischen Grundordnung und die innere Sicherheit unseres Landes«.
Nun heißt es, aus der Gemeinschaft wird ja niemand ausgestoßen, sondern nur aus dem öffentlichen Dienst.
Da tauchen zwei Fragen auf: Wie groß ist hier die Bedrohung und was ist öffentlicher Dienst? Der Verfassungsschutzbericht gibt eine doppelte Antwort:
Ende 1974 waren - soweit bekannt - insgesamt 1467 Linksextremisten im öffentlichen Dienst beschäftigt. Bei insgesamt 3,4 Millionen öffentlichen Bediensteten entfällt auf je 2302 Angehörige des öffentlichen Dienstes ein linksextremistischer Bediensteter. Von den 258 linksextremistischen Bundesbediensteten sind rund 78 Prozent (203) bei Bundespost und Bundesbahn in nachgeordneten Positionen tätig. Die Gefahr für den Staat scheint also nicht angsterregend. Aber eine andere Gefahr ist klar: Wenn nicht nur der Ministerialbeamte mit Autorität, sondern bereits der Briefträger und der Stationsvorsteher Elemente der staatlichen Friedensordnung sind, so befindet man sich auf dem Weg, der im anderen deutschen Staat voll zurückgelegt worden ist: Da ja die ganze Gesellschaft zur kollektiven Staatsordnung gehört, ist es unerträglich, daß irgendeiner, vom Lehrer bis zum Arzt, vom Bahnbeamten bis zum Metallarbeiter, mehr als unwesentliche Kritik ausübt.
Wenn jemand gegen das Gesetz verstoßen hat, soll er bestraft werden. Wenn ein Beamter seine Dienstpflicht verletzt hat, soll er gemaßregelt werden. Aber ich kann nur schwer verstehen, was eine zukunftsbezogene Beurteilung, eine zukunftsbezogene Verurteilung ist. Der Gedanke, es soll eine Gesinnungsprüfung mit abschließender »Prognose« über das zukünftige Benehmen des Geprüften geben, scheint mir, ich muß es sagen, in doppelter Hinsicht etwas absonderlich.
Zunächst wegen der Vergangenheit. Wenn ich recht verstehe, sollen junge Leute vorsorglich ausgeschlossen bleiben, weil sie ihre Weltanschauung nicht mehr ändern und möglicherweise ihre Pflicht dem Rechtsstaat gegenüber verletzen werden, wohingegen es sich die Bundesrepublik leisten konnte, Männern wichtige staatliche Positionen anzuvertrauen, die als Verteidiger des Rechtsstaates völlig versagt hatten.
Wenn man die Nürnberger Judengesetze als normales Recht trocken ausgelegt hatte, durfte man Staatssekretär im neuen Rechtsstaat werden. Wenn man die Gestapo polizeirechtlich gerechtfertigt hatte, durfte man in der freiheitlichen Grundordnung Rektor und Kultusminister werden. Die Kriterien, die nun verbieten sollen, Zollbeamter oder Dorfschullehrer zu werden, scheinen mir wahrlich strenger zu sein.
Warum ist dem so? Weil die nach 1945 Hochgekommenen trotz ihrer Vergangenheit mit Sicherheit diese freiheitlich-demokratische Grundordnung im Notfall nun verteidigen würden? Niemand kann garantieren, daß der junge Mann, der heute an Systemveränderung glaubt, in einigen Jahren wirklich die Grundrechte und die pluralistische Freiheit gegen einen revolutionären Umsturz verteidigen wird.
Aber wer garantiert denn, daß Aberhunderte von Beamten des heutigen Staates die Grundfreiheiten des Bürgers gegen die Staatsmacht verteidigen würden, wenn sich, durch diese oder jene wirtschaftliche Entwicklung gefördert, ein neues autoritäres Regime anbahnen würde?
Die größte Gefahr, die eine Demokratie von innen bedrohen kann, das sind nicht so sehr die ihr feindlich gesonnenen kleinen Gruppen. Das ist das Mitläufertum.
Dies sieht man ja seit einigen Jahren an den deutschen Universitäten. Wenn ein paar Revolutionäre, deren sture und brutale Intoleranz weitgehend die entgegengesetzte Intoleranz gezeitigt hat, den Frieden eines Hörsaals gewaltsam stören und zerstören können, so darum, weil sich die Hunderte von anwesenden Studenten so passiv benehmen wie ihre Vorgänger 1933.
Aber wenn jeder Anwärter auf eine Stellung im öffentlichen Dienst auf Herz und Nieren geprüft werden soll, wenn er Fragebogen (ja, Fragebogen!) auszufüllen hat, wenn dem Gymnasiasten schon klar wird, was er zu unterlassen und was er brav zu sagen hat, um später keine Schwierigkeiten zu bekommen, so vermeidet man weniger Gefahren für die Grundordnung, als wenn man junge Generationen zum Konformismus und zu einem gefährlichen Mitläufertum verleitet.
Dabei ist doch die Gefahr von innen mit der Gefahr von außen gar nicht so sehr verknüpft. Bei einem Jugendlichen, der mit ketzerischen Ideen herumläuft, sind die Chancen, daß er ein Agent sei, geringer als bei einem biederen Ostflüchtling, der durch Verheimlichung seinen Weg bis hoch nach oben machen kann. Und daß dieser Jugendliche ein unbewußter Agent sei, das erinnert wirklich allzusehr an den im Osten für alle Abweichenden gebrauchten Begriff des »objektiven« Verrats.
Agenten: wenige. Rebellen: viel mehr. Aber Rebellen wogegen? Wenn es gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, muß die Rebellion mit Entschiedenheit abgelehnt werden. Was ist nun aber diese Grundordnung?
Hier herrscht eine erstaunliche Konfusion. Man tut, als sei die politische Ordnung mit der Gesellschaftsordnung identisch. In der Urteilsbegründung des Bundesverfassungsgerichts über die Zulassung zum öffentlichen Dienst wird von denen gesprochen, die - ich zitiere - »die rechts- und sozialstaatliche Ordnung ablehnen«. Soll das etwa heißen, daß die gesellschaftliche Ordnung in der Bundesrepublik als ebenso vorbildlich und erhaltungswürdig dargestellt wird wie der politische Pluralismus und die Grundrechte?
Wenn ja, so birgt dies eine echte Gefahr: Daß immer mehr anspruchsvolle Jugendliche glauben, man könne das Ungerechte an dieser Gesellschaftsordnung nicht verändern, ohne zugleich die rechtsstaatliche Ordnung zu beseitigen!
Glücklicherweise wird auch eine andere Sprache gesprochen. Ich möchte hier den schönen Artikel zitieren, den der Vorsitzende und Kanzlerkandidat der großen Oppositionspartei zum jüngsten Evangelischen Kirchentag geschrieben hat:
Allen voran unseren Begriff von Freiheit, der nie nur die eigene Freiheit meint, sondern immer auch die Freiheit des anderen, des nächsten einschließt. Dieses Verständnis von Freiheit schließt auch die Pflicht ein, meinem Nachbarn seine Freiheit zu lassen, ja, sie ihm aktiv zu verschaffen und dazu entsprechend dem Gebot der sozialen Gerechtigkeit notfalls jene gesellschaftlichen Hindernisse hinwegzuräumen, die seiner freien Selbstentfaltung im Wege stehen. Die soziale Gerechtigkeit ist ein Ziel, kein Zustand, keine durch die Grundgesetzformulierungen bereits geschaffene Wirklichkeit. Tun wir nicht so wie Bismarck, der in dem zitierten Sozialistengesetz Staats- und Gesellschaftsordnung auf einen Nenner brachte. Vor allem, da ja das Grundgesetz die Veränderung und sogar die Verwandlung zuläßt und vorsieht.
Ist man z. B. schon »auch so einer«, wenn man, über die Spekulation empört, das Eigentumsrecht nicht an die Spitze aller Werte stellt und wegen dem für Häuserbau geeigneten Boden an den Artikel 15 des Grundgesetzes denkt?
Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können ... in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Untergräbt man die Grundfreiheiten, wenn man nach Regulierungen sucht, die endlich den Respekt für die Würde der Person den Alten, den Kranken, den Wirtschaftsschwachen in der Tat zugestehen würde? Oder wenn man sich daran stößt, daß der Gewinn privat bleiben und der Verlust dank Zuschuß der öffentlichen Hand sozialisiert werden soll? Oder daran, daß der Finanzverbrecher mit Krawatte weniger bestraft werden mag als der Motorraddieb mit langen Haaren? Oder daß ein Vorstandsmitglied, bei schlechter Arbeit für 30000 oder 50000 DM pro Monat höchstens riskiert, mit einer hohen Abfindung bequem weiterleben zu können, während der einwandfrei arbeitende Angestellte oder Arbeiter, der durch dieses »Mißmanagement« seine Stelle verliert, zwar besser daran ist als seine Vorfahren, aber doch um das tagtägliche Schicksal der Seinen bangen muß?
Ja, bangen! Was mich besorgt für den inneren Frieden der Bundesrepublik, das sind die Auswirkungen der neuen Angst. Ich meine hier nicht die Angst vor der umstürzlerischen Bedrohung. Auch nicht so sehr die bei manchem entstehende Angst, sie könnten die Forderungen der inquisitorischen Verteidiger der Grundordnung nicht genügend erfüllen. Sondern die einfache Angst vor der Zukunft, die durch Wirtschaftunsicherheit und Arbeitslosigkeit entsteht.
Bis jetzt gibt es noch keine Anzeichen dafür, daß sich die Bürger in Angst von den demokratischen Parteien abwenden. Aber das ist kein genügender Grund, um unbesorgt zu sein.
*
In Sorgen- und Krisenzeit: Was heißt es denn, dem inneren Frieden dienen? Zunächst, keine falschen Hoffnungen erwecken. Eine Demokratie ist erst dann mündig, wenn die Männer, denen die Macht anvertraut wurde, und diejenigen, die legitim ihren Platz einnehmen wollen, fähig sind, bittere Wahrheiten zu sagen, und wenn die Regierten bereit sind, diese Wahrheiten zu hören. Was eine mündige Demokratie ist, das hat Großbritannien 1940-41 gezeigt.
Sodann: Nicht versuchen, die allgemeine Sorge durch Ablenkung aus dem Weg zu räumen. Ablenkung auf Sündenböcke, die am Rande des politischen Spiels stehen. Ablenkung durch Verteufelung des Gegners im normalen Kampf um die Macht.
Das freie Wort und die freie Schrift dienen dem Frieden nicht, wenn sie im Parlament zur gegenseitigen Beschimpfung, in der Presse zu ständiger Verdächtigung von Männern und von Parteien führen.
Das ist um so schlimmer, als es darum gehen sollte, echte Spannungen und Gegensätze in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft klar darzulegen und auszutragen. Nicht, daß es in der Gesellschaft nur Konflikte gäbe, wie es bei der extremen Linken gesagt und sogar manchmal in Richtlinien für Erzieher niedergeschrieben wird. Aber es ist ebensowenig angebracht, so zu tun, als gäbe es nur Sozialpartner, die ungefähr so zusammenhalten sollten wie Partner, die gemeinsam und ebenbürtig ein Unternehmen besitzen.
Gerade in Krisenzeiten ist es für die Schwachen besonders gefährlich, daß Interessengegensätze vertuscht werden. Gegensätze, die nicht selten im dunkeln bleiben, wenn sie »die da unten« und »die da oben« gegenüberstellen, wobei »die da oben« nicht nur die Mächtigen der Geld- und Privatwirtschaft, sondern auch die Träger der Staats- oder Gewerkschaftsmacht sein können.
Denn besonders von den Schwachen wird in Krisenzeiten verlangt, daß sie sich friedlich verhalten, daß sie sich zufriedengeben. Den inneren gerechten Frieden anstreben, das heißt, gerade in schwieriger Wirtschaftslage die Schwäche der Schwachen nicht ausnutzen, sei es nur, indem man das sogenannte freie Spiel der Kräfte walten läßt.
*
Bei all dem bleibt unbestritten, daß die Bundesrepublik für den inneren wie den äußeren freiheitlichen und gleichheitlichen Frieden viel geleistet hat, auch und vor allem im internationalen Vergleich.
In der Umwelt muß das Geleistete immer wieder hervorgehoben werden, um noch bestehende Vorurteile - antideutsche Vorurteile und sozialphilosophische Vorurteile - zu beseitigen. Das versuche ich auch stets zu tun, wenn ich in Frankreich oder in anderen Ländern spreche.
Innerhalb der Bundesrepublik hingegen sollte man eher kritisch fordernd hervorheben, was noch nicht erreicht ist oder was sich von dem bereits Erreichten wieder entfernt. Hat die Bundesrepublik doch das tragische Glück, durch den notwendigen Gegensatz zum unmenschlichen Hitler-Regime gezwungen worden zu sein, ihr politisches System auf einer Ethik aufzubauen.
Es ist kein Zufall, daß eine der beiden großen Parteien als »geistige und sittliche Wurzeln des sozialistischen Gedankenguts« »Christentum, Humanismus und klassische Philosophie« nennt, während die andere ein C in ihrem Namen führt, das auf Nächstenliebe und nicht auf Scheiterhaufen hinweisen soll.
Kritisch fordernd wollte ich also auch heute sein. Ob nun der Friedenspreisträger friedsam gesprochen hat, das bleibe dahingestellt. Daß er es lediglich friedensfordernd gemeint hat, das darf er seinen geduldigen Hörern zum Abschluß versichern.
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck und jede andere Art der Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen, die urheberrechtlich nicht gestattet ist, werden verfolgt. Anfragen zur Nutzung der Reden oder von Ausschnitten daraus richten Sie bitte an: m.schult@boev.de
Alfred Grosser
Dankesrede des Preisträgers
Chronik des Jahres 1975
+++ Der Vorsitzende der West-Berliner CDU, Peter Lorenz, wird Ende Februar 1975 von Terroristen der »Bewegung 2. Juni« entführt, die inhaftierte Gesinnungsgenossen freipressen wollen. Lorenz wird freigelassen, nachdem die Forderungen erfüllt werden. Die deutsche Botschaft in Stockholm wird Ende April durch Terroristen des »Kommandos Holger Meins« überfallen, um die Freilassung von 26 RAF-Häftlingen zu erwirken. Die Bundesregierung erfüllt die Forderungen dieses Mal nicht, woraufhin zwei Mitglieder der Auslandsvertretung getötet werden. Die restlichen Geiseln können von der Polizei befreit und die Terroristen festgenommen werden. +++
Die bisherige Handhabung des Extremisten-Beschlusses wird Ende Juli durch das Bundesverfassungsgericht dahingehend aufgehoben, dass ein Bewerber für den öffentlichen Dienst nicht allein wegen seiner Zugehörigkeit zu einer verfassungsfeindlichen Organisation abgelehnt werden darf. Ausschlaggebend soll vielmehr sein Verhalten sein. +++ Am 1. August wird die Schlussakte der »Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa« (KSZE) durch 35 Staaten unterzeichnet, deren Kernpunkte die souveräne Gleichheit aller Staaten, Unverletzbarkeit der Grenzen, friedliche Beilegung von Konflikten, Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, Achtung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten und das Selbstbestimmungsrecht der Völker sind. +++ Der spanische Staatschef Francisco Franco, der das Land 36 Jahre lang als Diktator regiert hat, stirbt Ende November im Alter von 82 Jahren. +++ Jelena Bonner nimmt für ihren Mann Andrei Sacharow, den führenden Kopf der Bürger- und Menschenrechtsbewegung in der UdSSR, in Oslo den Friedensnobelpreis entgegen. Im darauffolgenden Jahr werden er und seine Frau festgenommen. +++ US-amerikanische Wissenschaftler geben bekannt, dass der Ozonmantel der Erde, der vor den krebserregenden UV-Strahlen schützt, gefährdet ist. Längerfristig kann die Zerstörung der Ozonschicht Klimaveränderungen herbeiführen. +++
Biographie Alfred Grosser
Der am 1. Februar 1925 in Frankfurt am Main geborene Alfred Grosser muss 1933 im Alter von acht Jahren mit seiner Familie Deutschland verlassen und nach Frankreich emigrieren. Nach dem Studium und dem Staatsexamen in Germanistik schließt er sich der französischen Widerstandsbewegung an.
Von 1950 bis 1951 ist Grosser stellvertretender Leiter des UNESCO-Büros in der Bundesrepublik. Anschließend nimmt er eine Dozentenstelle an der Sorbonne an. Ab 1956 ist Grosser hauptamtlicher Forschungsdirektor an der «Fondation nationale des sciences politiques» und Professor am «Institut d’etudes politiques» in Paris.
In zahlreichen Veröffentlichungen und Vorträgen setzt er sich immer wieder für den Dialog zwischen den Nationen ein und nimmt unter anderem in Le Monde als Kolumnist öffentlich Stellung zu politischen Fragen.
Als Generalsekretär des »Französischen Komitees für den Austausch mit dem neuen Deutschland« gilt Alfred Grosser als Wegbereiter der deutsch-französischen Aussöhnung. Durch seinen Einsatz für eine friedliche Zweistaatenlösung im israelisch-palästinensischen Konflikt stößt er besonders in Israel immer wieder auf Kritik.
Bis zu seinem Tod am 7. Februar 2024 lebte Alfred Grosser in Paris.
Auszeichnungen
2018 Eugen-Kogon-Preis
2014 Henri-Nannen-Preis für das publizistische Lebenswerk
2013 Theodor-Wolff-Preis für das Lebenswerk
2013 Steiger Award
2012 Medienpreis des Deutsch-Französischen Journalistenpreises (DFJP)
2004 Abraham Geiger-Preis des Abraham-Geiger-Kollegs an der Universität Potsdam
2004 Wilhelm-Leuschner-Medaille
2003 Großes Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband
2002 Humanismus-Preis des Deutschen Altphilologenverbands
2001 Großoffizier der Ehrenlegion
1998 Grand Prix de l’Académie des Sciences morales et politiques
1996 Schillerpreis der Stadt Mannheim
1995 Cicero Rednerpreis
1991 Offizier der Ehrenlegion
1986 Schärfste Klinge der Stadt Solingen
1986 Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt am Main
1985 Großes Verdienstkreuz mit Stern
1978 Theodor-Heuss-Medaille
1975 Großes Verdienstkreuz
1975 Goethe-Medaille
1975 Friedenspreis des Deutschen Buchhandels
Bibliographie
Le Mensch. Die Ethik der Identitäten
J. H. W. Dietz Verlag, Bonn 2017, ISBN 9783801204990, Gebunden, 288 Seiten, 24.90 EUR
Die Freude und der Tod. Eine Lebensbilanz
Rowohlt E-Book, Reinbek 2011, ISBN 978-3-644-00991-2, 288 Seiten, 16.99 EUR
Wie anders sind die Deutschen?
C.H. Beck Verlag, München 2002, ISBN 9783406493287, Gebunden, 237 Seiten, 19.90 EUR